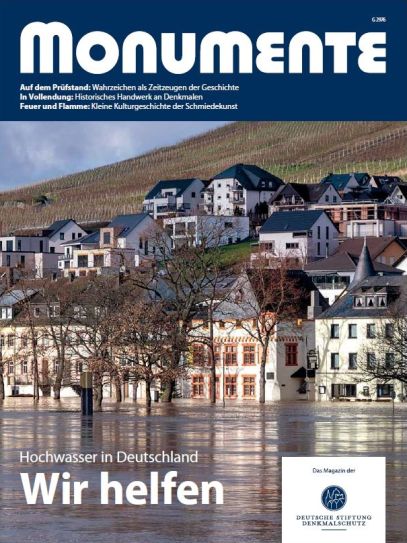Nach 1945 Herrscher, Künstler, Architekten August 2017 M
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther
Hyparschalen
Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
Die Rede ist von den hyperbolischen Paraboloidschalen, die Ulrich Müther in der DDR zu seinem Markenzeichen gemacht hat und die ihn, in einem System der Kollektive und des Gleichen unter Gleichen, singulär werden ließen.
Die hyperbolische Paraboloidschale, von Müther Hyparschale genannt, ist eine doppelt gekrümmte Fläche, die trotz ihrer Kurven aus Geraden gebildet wird. Das bedeutet, dass die Spritzbetonflächen mittels gerader Schalbretter vorbereitet werden können. Die Schalen als Dächer, oft schwingenden Flügeln gleich, sind dominierend für die Erscheinung des Gebäudes. Mehrere gekrümmte Schalen können aneinandergefügt werden und dadurch immer neue Formen entstehen lassen.

Über 70 Schalenbauten in 36 Berufsjahren zeugen von offenkundigem Erfolg des Bauingenieurs. Den beruflichen Durchbruch stellte 1966 die Halle für die Ostseemesse in Rostock dar, Müthers viertes Projekt. Mit der gekrümmten Hyparschale, seinem liebsten Kind, wurde er bekannt, sein Arbeitsfeld umfasste aber ein weitaus größeres Repertoire im Betonschalenbau: Ende der 1960er-Jahre entwickelte Müther zum Beispiel ein Konstruktionsverfahren für Bobbahnen, nach dem dann viele weitere Bahnen gebaut wurden. Die Rennrodelbahn in Oberhof – noch heute jeden Winter bei internationalen Wettkämpfen befahren – ist der Prototyp, bei dem Müther erstmalig ein schalungsloses Nassspritzverfahren erprobte.
Gaststätten, Schwimmhallen, Orchesterpavillons, Bushaltestellen, selbst Kirchen und Moscheen gehörten zum Programm Müthers, der in der Regel die Konstruktion der Dächer zu von Architekten oder Ingenieuren entworfenen Gebäuden lieferte.
Für einige Planetarien konstruierte er die zentrale Kuppel. So überzeugend, dass er nicht nur in Libyen, in Kuwait, Finnland und Kolumbien baute, sondern sogar 1983 in die kapitalistische BRD, nach Wolfsburg, „ausgeliehen“ wurde und mit 10.000 VW-Golf „als Lohn“ in die DDR zurückkehrte. Was die Frage aufwirft: Wie konnte sich eine solche Karriere entwickeln in einem Land, in dem offiziell nur im Kombinat gearbeitet werden durfte?

Ulrich Müther wurde 1934 als älterer von zwei Söhnen des Architekten Willy Müther geboren. Als Kind eines Unternehmers war ihm in der DDR der direkte Weg ins Ingenieurstudium verwehrt, er ging den Umweg über die Zimmermannslehre zur Ingenieurschule für Bauwesen Neustrelitz. Bei seiner ersten Arbeitsstelle in Berlin beschäftigte er sich mit Kraftwerken und Kühltürmen. Ein daraufhin bewilligtes Fernstudium an der Technischen Universität Dresden und seine Diplomarbeit dort führten ihn 1963 zum Thema hyperbolische Paraboloidschale.
Die richtungsweisenden Betonschalen des spanischen Ingenieurs Félix Candela in Mexiko spielten für ihn eine besondere Rolle. In Berlin besaß die Kongresshalle, bekannt als "Schwangere Auster", die ebenso wie Müthers Bauten auch eine politische Bedeutung besaß, bereits 1956 ein Dach in diesen Formen.
Müther tüftelte an der verbesserten Produktion der Paraboloidschalen. Das elterliche Bauunternehmen in Binz führte Müther seit 1959. Als dieses nach mehreren Vorstufen 1972 endgültig verstaatlicht und zum VEB Spezialbetonbau Rügen umgewandelt wurde, war Müther mit seinen Schalenbauten schon so etabliert, dass er die Eingliederung in ein Baukombinat verhindern konnte. Seine Erfindung zum Betonschalenbau war zu begehrt, er war konkurrenzlos.

Die Solitäre an der Ostsee und auf Rügen, DDR-Ferienziel und Heimat Müthers, waren das eine. Die Strandwache in Binz mutet an wie aus einem James-Bond-Film, die eleganten Gaststätten mit Meerblick an der Küste hätten mit ihrer Extravaganz ebenso gut in Kalifornien stehen können. Aber oft wurde die Architektur Müthers mit ihren dynamischen Formen auch in einen bewussten Gegensatz zu den monotonen Großwohnsiedlungen gesetzt, die ab 1971 unter Erich Honecker flächendeckend in der DDR entstanden. Viele seiner leichten Betonsegel befinden sich inmitten von Reihen einschüchternder Plattenbauten: architektonische Individualität für die kollektive Seele.
In seiner Mischung aus eigenständigem Unternehmer und volkseigenem Arbeiter war Müther ein gefragter Spezialist. Er und seine Bauten, die er im Gesamtpaket von der Planung bis zur Ausführung anbot, waren Exportschlager geworden. Sie dienten als gern genutztes Zeichen von Modernität des politischen Systems, die Geschäfte liefen gut. Das sollte sich ausgerechnet dann ändern, als Müther 1990 seine Firma rückübereignet wurde. 1999 musste er Konkurs anmelden. Denn nicht nur ästhetische Gründe hatte die Funktionäre bewogen, Müther seine aufregenden Dächer bauen zu lassen: die Summe aus wenig Baumaterial und vielen Arbeitsstunden – von bis zu 100 Mitarbeitern – war für DDR-Verhältnisse ideal, für die Marktwirtschaft nach 1990 fatal.




Mittlerweile gelten seine Bauten als Ikonen der DDR-Moderne, die spektakulären Entwürfe entlang der Ostseeküste sind geradezu Kult. Doch der Weg dahin war lang. Das Bewusstsein für den Wert der sogenannten Ost-Moderne musste erst reifen und muss es mancherorts immer noch. Einige von Müthers Bauten sind schon verloren: abgerissen, zur Unkenntlichkeit verbaut, fast unrettbar verrottet. Der spektakulärste Verlust ist in Berlin zu beklagen. Im Jahr 2000 wurde trotz Denkmalschutz und großer Proteste aus der Fachwelt – und nicht nur aus der – das „Ahornblatt“, eine ehemalige Großgaststätte von 1973 mit fünf steil hochzeigenden Schalenrändern, dem Erdboden gleichgemacht. Die Tragik der Geschichte: Erst mit diesem Akt des Vandalismus, mit dieser Nichtachtung des DDR-Städtebaus allgemein, wurde Müther ein fester Begriff bei Architekturliebhabern, geachtet als Baupionier und willkommen als Redner. „Ich bin aus der Versenkung wieder hochgeholt worden“, erinnerte er sich später. 2003 wurde er als einer der fünf weltweit führenden Entwickler des Schalenbetonbaus gewürdigt.

Am 21. August 2007 starb Ulrich Müther in Binz. Bei einigen seiner Bauwerke konnte er noch in seinen letzten Lebensjahren eigenhändig bei der Sanierung helfen, wie 2003 bei der Christuskirche in Rostock. Diese Aufgabe müssen seitdem andere übernehmen. Zehn Jahre nach seinem Tod sind zumindest das Bewusstsein und die Bereitschaft dazu vorhanden – wenn es auch oft ein mühsamer Prozess ist, die Flügel weiter segeln zu lassen.
Beatrice Härig

Hyparschale Templin - Förderprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
Hunderte haben hier gesessen, haben im lichtdurchflut eten Speisesaal gegessen und durch die Fensterfronten in den durch Glasvitrinen, Freilichtbühne und Springbrunnen gestalteten Park mit seinem ausgewählten Baumbestand geschaut: Das – immer noch – malerisch gelegene FDGB-Ferienheim Salvador Allende im uckermärkischen Templin war von 1972 an fast drei Jahrzehnte Ziel vieler Urlauber in der DDR und der Templiner selbst. Überspannt ist der 20 mal 20 Meter große Speisesaal mit einem der berühmten hyperbolischen Paraboloid-Dächer nach Ulrich Müthers Plänen.
Nur sieben Zentimeter ist es dick – und ich stehe bei meinem Termin Anfang Juni mitten auf ihm mit Dipl.-Ing. Marko Koch vom Bauamt Templin, verstehe seine Begeisterung über das doppelt geschwungene Dach, das ausschließlich durch die geraden Druckbalken an seinen Rändern gehalten wird, und versuche zu vergessen, dass unter mir keine einzige Stütze diese Konstruktion sichert. Das übernimmt ein unterirdisch verlegtes, etwa ein Meter breites Zugband von einem Fußpunkt zum anderen. Mehrmals betont Koch, dass man eigentlich ohne Probleme alle Streben der Fensterfronten entfernen könnte, weil sie für die Normalkräfte des Daches keine tragende Funktion haben und nur dem Ausgleich der Windlasten dienen. Besondere Hochachtung hat der Bauingenieur davor, dass man die geschwungene Konstruktion zu ihren Entstehungszeiten nur annähernd, nicht bis ins Letzte berechnen konnte. Kein Computerprogramm war im Einsatz, dafür Erfahrung, viel Holz für die aufwendige Verschalung, eine Bewehrungsebene und Spritzbeton. Das macht es für mich nicht gemütlicher auf dem Dach, steigert aber die Faszination für die Schönheit der Schwünge vor der Kulisse der hübschen Altstadt von Templin – auch wenn die unmittelbare ruinöse Umgebung alles andere als ansehnlich ist.
Umbauten in und Anbauten an der Halle haben zu DDR-Zeiten nicht vermocht, den Bau in seiner Großzügigkeit zu zerstören, wohl aber die Zeit nach der Wiedervereinigung. Einige Jahre noch bot sie Platz für eine Disko, seitdem steht sie leer mit den üblichen Folgeerscheinungen: Von der Verglasung ist nichts mehr vorhanden, Wasser drang durch undichte Stellen ins Dach ein, die Dämmung aus Holzfaserplatten war permanent durchfeuchtet und quoll auf.
Die Stadt Templin hat den Wert des ehemaligen Speisesaals erkannt. 2016 sanierte sie mit Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) das Dach. Weitere Schritte hängen nun von der künftigen Nutzung ab. Das Bettenhaus des Ferienheims wurde 2014 abgerissen. Der unmittelbare Anbau am Speisesaal, der weitere Säle und Wirtschaftsräume beherbergt, soll in Teilen erhalten bleiben. Der Park samt seiner Wegeanlage wird zum Großteil wieder hergestellt und an die Innenstadt von Templin angebunden.
Trotz seines heute verwahrlosten Zustands kann man sich jetzt schon den lichten Saal vorstellen, den nach weiteren restaurierenden Bauabschnitten keine teils zugemauerten Fronten mehr entstellen werden. Die noch zu erkennende Schalenstruktur in der Decke – darauf legen die Denkmalpfleger Wert – bleibt sichtbar, um Müthers Konstruktionsprinzip ablesbar zu lassen. Faszinierend sind seine schwebenden Dächer aber auch ohne Ingenieurswissen – selbst wenn man im Normalfall nicht auf, sondern vor ihnen steht.
Beatrice Härig
Lesen Sie zu diesem Artikel auch hier das Interview mit dem Leiter des Müther-Archivs Wismar, Prof. Matthias Ludwig
Einen Monumente-Artikel zur Architektur der 1960er-Jahre lesen Sie hier.

Die Zukunft
von Müthers Erbe:
Das Müther-Archiv Wismar, angesiedelt an der Hochschule Wismar, existiert schon länger, ist aber erst jetzt finanziell in der Lage, den Bestand systematisch zu bearbeiten und zugänglich zu machen. 2006 hatte Müther seinen umfangreichen beruflichen Nachlass dem Archiv übereignet. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert die nächsten drei Jahre den Ausbau des Archivs zu einer dauerhaft nutzbaren Forschungs- und Lehreinrichtung.
Die Restaurierung des Hyparschalen-Daches in 17268 Templin, Am Bürgergarten 1, wurde neben der DSD mit Hilfe der Wüstenrot Stiftung auch vom Bund, vom Land und der Kommune finanziert.
Die Wüstenrot-Stiftung beschäftigt sich in einem Modell-Projekt seit 2014 mit der Restaurierung zweier Müther-Gebäude: dem Rettungsturm der Strandwache in Binz und dem Musikpavillon „Kurmuschel“ in Sassnitz. Über die diffizile Betoninstandsetzung und den Umgang mit Müther-Bauten wird es nach Abschluss der Arbeiten eine Publikation geben.
Nicolaihaus:
Zum Thema ehemaliges „Ahornblatt“ in Berlin, aber auch zum Thema Regierungsbauten im Laufe der Geschichte empfiehlt sich der Besuch des Nicolaihauses in Berlin, dortiger Sitz der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, in dem seit Frühjahr dieses Jahres ein Stadtteilmodell ausgestellt ist. Das dreidimensionale Modell gibt neben dem gegenwärtigen Zustand der Spreeinsel in begleitenden Modulen die Stadtplanungsgeschichte von Berlins Mitte seit 1945 zur Hauptstadt der DDR wieder. Weitere Module befassen sich mit der Historie verschiedener, zum Teil nicht mehr existierender Gebäude wie dem Palast der Republik und eben dem „Ahornblatt“ als Teil eines städtebaulichen Gesamtkomplexes auf der Fischerinsel.
Das Nicolaihaus, Brüderstraße 13, 10178 Berlin, mit der Ausstellung über den Verleger, Schriftsteller und Aufklärer Friedrich Nicolai und dem Stadtteilmodell kann jeden 1. und 3. Sonntag im Monat von 14–17 Uhr besichtigt werden. Gruppenführungen nach Anmeldung, Tel. 030 626406-0
Literatur:
Aus einer Dissertation hervorgegangen, mit über 750 Abbildungen und Plänen, Werkverzeichnis, Orts- und Personenregister:
Tanja Seeböck: Schwünge in Beton. Die Schalenbauten von Ulrich Müther. Beiträge zur Architekturgeschichte und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern; Bd. 13. Thomas Helms Verlag, Schwerin 2016.
ISBN 978-3-944033-02-0, 454 S., 58€
Handlicher, informativer und gut gestalteter Führer zu den Bauten Müthers vorwiegend auf der Insel Rügen und in Rostock:
Rahel Lämmler und Michael Wagner: Ulrich Müthers Schalenbauten in Mecklenburg-Vopommern. Niggli Verlag, Salenstein 2010, 4. Auflage 2015. ISBN 978-3-7212-0662-33, 120 S., 25 €
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Otto Bartning und seine Kirchen 09.03.2016 Bartning Kirchen Spiritualität in Serie

Otto Bartning gehört zu den bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Wegweisend sind seine Raumschöpfungen im Bereich des protestantischen Kirchenbaus.
-
Mittelalterliche Wandmalereien in Behrenhoff 16.01.2018 Die Hölle Vorpommerns Die Hölle Vorpommerns

In der Dorfkirche von Behrenhoff haben sich eindrucksvolle Darstellungen des Fegefeuers erhalten.
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
Lesen Sie 0 Kommentare anderer Leser
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz