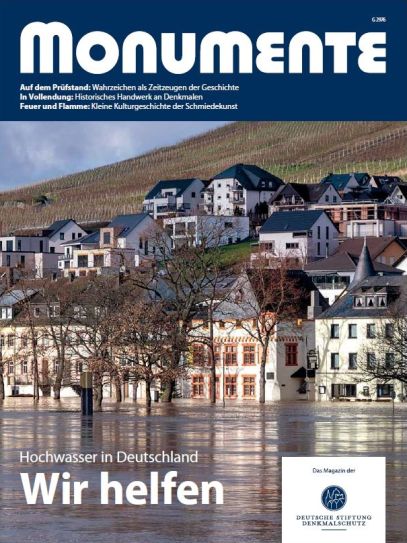Kleine und große Kirchen Nach 1945 Juni 2017
Kirchenbau in der DDR
Wille gegen Widerstand
Was paradox klingt, ist es auch: In den 1970er- und 1980er-Jahren gab es eine ganze Reihe von Kirchenneubauten in der DDR. Es lohnt der Blick auf ein weitestgehend unbekanntes Thema mehr als 25 Jahre nach der Wiedervereinigung.
Groß, sehr groß, an zentraler Stelle und in bester Innenstadtlage: Die neue Kirche, die 2015 in Leipzig geweiht wurde, demonstriert Präsenz. In ganz Deutschland werden Kirchen profaniert, geschlossen, umgenutzt – ein Thema, das Gläubigen und Denkmalpflegern allerorten begegnet und sie beschäftigt. In Leipzig aber liegt die neue Kirche selbstbewusst und massig-modern mit edel schimmernder Porphyr-Fassade vor der Silhouette des Neuen Rathauses. Und dazu ist die Propsteikirche St. Trinitatis – im wenn überhaupt konfessionellen, dann protestantisch geprägten Sachsen – auch noch katholisch. Sie ist der größte sakrale Neubau nach der Wende in den östlichen Bundesländern. Erklären lässt er sich durch den steten Zuzug von Katholiken aus West- und Süddeutschland und eine junge, aktive und wachsende Gemeinde.
Die drei Leipziger Propsteikirchen St. Trinitatis
Hinter dieser Erfolgsgeschichte steckt noch eine andere. Eine, die tief in die deutsche Historie führt, von Restriktionen und Gängeleien handelt – und dem zähen Widerstand dagegen. Sie beginnt Ende des 19. Jahrhunderts: In der Nähe des heutigen Standorts entsteht 1847 die erste Trinitatis-Kirche in Leipzig. Im Krieg schwer beschädigt, wird die neogotische Kirche 1954 gesprengt. Die Gläubigen haben kein Dach mehr über dem Kopf. Nicht nur damit teilt sie das Schicksal vieler Gemeinden in der DDR. Auch das jahrzehntelange Ausweichen auf diverse evangelische Kirchenbauten Leipzigs – unter anderem in die dann 1968 ebenfalls gesprengte Universitätskirche St. Pauli – findet Parallelen in anderen Städten. Die vor der Sprengung gemachte Zusage für einen Kirchenneubau wurde vom Rat der Stadt mit kalter Konsequenz verzögert und Anfang der 1970er-Jahre komplett zurückgezogen. 1978 kommt es dann zur überraschenden Wende: Planungen zur zweiten Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig werden aufgenommen. 1982 wird die neue Kirche geweiht.

Dass im atheistisch ausgerichteten Arbeiter- und Bauernstaat, wo der Marxismus-Leninismus das Denken beherrschen und Religion keinen Platz haben sollte, Kirchenbauten nicht als unterstützenswerte Bauaufträge angesehen wurden, liegt auf der Hand. Was hatte also die Offiziellen zu einem Umdenken bewogen?
Es war das Devisenbeschaffungsprogramm eines Staates, der in den 1980er-Jahren praktisch zahlungsunfähig war. Schon wenige Jahre nach der Teilung Deutschlands liefen über die Kirchen in der Bundesrepublik massive finanzielle Hilfsprogramme für die Gemeinden in der DDR an, in der die Kirchensteuer seit 1956 nicht mehr von staatlichen Stellen eingezogen, sondern von den Kirchenkreisämtern eingesammelt wurde. Die Geldströme aus dem Westen machte sich auch der Staat mit einem abenteuerlichen Konstrukt zunutze: Waren und Güter aus dem Westen wurden von den West-Kirchen gekauft und in die DDR geliefert. Dort wurde der Preis in DDR-Mark an die Ost-Kirchen bezahlt. So liefen die sogenannten Kirchengeschäfte A und C. Das Kirchengeschäft B handelte zusätzlich mit dem Freikauf von Häftlingen. Dieses System, koordiniert von Alexander Schalck-Golodkowski in der Abteilung „Kommerzielle Koordinierung (KoKo)“ lief bis 1990. 1972 wurde zusätzlich nach einem Beschluss des DDR-Ministerrats ein Sonderbauprogramm für Kirchen verabschiedet. Erich Honecker war im Jahr zuvor erster Mann im ZK geworden. Er bemühte sich um einen moderateren Führungsstil, was den Umgang mit den Kirchen einschloss – auch hier ging es um die Beschaffung von Devisen. Die Gemeinden konnten für dringend benötigte Kirchenneu- und -umbauten, Gemeindezentren und vor allem auch restauratorische Maßnahmen D-Mark aus dem Westen erhalten und mit dem Geld über die Außenhandelsgesellschaft Limex Bauleistungen staatlicher Unternehmen bezahlen. Dafür wurde 1:1 in DDR-Mark umgerechnet. Damit waren die Kirchen in der Lage, tatsächlich im größeren Umfang sakrale Gebäude neu zu errichten. Erkauft wurde eine Linderung der üblichen Genehmigungsschwierigkeiten, die sonst – siehe die Leipziger Trinitatiskirche – über Jahrzehnte die Kirchengemeinden lahmgelegt hatten.
Einfach waren die Bauprojekte dennoch nicht: Von Beginn an kämpfte die neue Trinitatiskirche mit Problemen, und das nicht zufällig. Das zugewiesene Grundstück am Rosental war weit entfernt von der ursprünglichen Innenstadtlage. Zudem war es feucht und sumpfig. Vom Tag der Weihe im Jahr 1982 an litt die Kirche unter Problemen der Standsicherheit, bald begann das Dach undicht zu werden. Propst Gregor Giele von der Gemeinde St. Trinitatis, Initiator des jüngsten Neubaus, erinnert sich: „Es war ungünstig, wenn es während des Gottesdienstes regnete. Dann wurde man in der Kirche nass. Unter die Kirchenbänke musste man Klötzchen legen, um die Neigung des abgesackten Bodens auszugleichen.“


Ausgeführt wurde die Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig von der Bauakademie der DDR – für die dort arbeitenden Architekten und Ingenieure eine eher ungewöhnliche Aufgabe und eine wohltuende Abwechlsung zu den sonstigen, oftmals stark seriell geprägten Aufträgen. Sie entwarfen unter dem leitendem Architekten Udo Schultz ein Ensemble, das neben dem Kirchenraum noch das Gemeindezentrum, Wohnungen und Unterrichtsräume aufnahm. Mit seinem wuchtigen quaderförmigen Äußeren, gegliedert durch Betonwabensteine, einem vorspringenden schieferverkleideten breiten Attikadach und klammernden Stahlpylonen erinnert der Stahlskelettbau an die Architektursprache des Brutalismus. Der freistehende Glockenturm nimmt diese Formen auf. Für ihn musste eine Sondergenehmigung eingeholt werden, die nach den Erinnerungen des Architekten Erich Honecker persönlich erteilte. Angeblich wurde der bauwerkprägende Stahl deshalb eingesetzt, um mit dem teuren Material möglichst viel Westgeld einzutreiben: eine besondere Version von „form follows function“.
Zurzeit erfährt der Brutalismus eine Rehabilitation, er hat geradezu eine Fangemeinde gewonnen, aber lange Jahre wurde die Architektur nur als störend im Stadtbild wahrgenommen. Das und die immerwährenden Bauschäden, die Ende der 1990er-Jahre kaum noch zu beheben waren, führten zum kühnen Plan der dritten Trinitatiskirche. Die Trinitatiskirche II wurde profaniert und zum Verkauf bereit gemacht, der aufsehenerregende Neubau in der Innenstadt 2015 geweiht und gefeiert. Keine drei Wochen später kam für die euphorisierte Kirchengemeinde eine unerwartete Nachricht aus Dresden: Das Landesamt für Denkmalpflege stellte den Altbau unter Denkmalschutz mit besonderem Augenmerk auf die Innenausstattung des Berliner Metallgestalters Achim Kühn. Das ist auch dringend notwendig: In den anderthalb Jahren Leerstand litt das ehemalige Gotteshaus stark unter Vandalismus. Die außergewöhnliche, gewellte Altarwand aus Stahl, die Doppelflügeltüren und das Lesepult werden – sollte es gar zu einem Abbruch des Gebäudes kommen – museal ausgestellt werden. Gerade laufen Verkaufsverhandlungen, es wird mit einigen Schwierigkeiten nach einer für alle verträglichen Lösung gesucht.
Ein Paradebeispiel für den Denkmalschutz, der zwischen unterschiedlichen Interessen vermitteln muss. Die Kirche soll, mit all ihren gravierenden Bauschäden, als Mahnmal der problematischen DDR-Zeit erhalten bleiben. Ihre architektonische Leistung gewinne an Wert, weil sie – wie es die Denkmalpfleger formulieren – nur in einem schwierigen politischen Umfeld errungen werden konnte. Sie gehöre zudem als Objekt einer abgeschlossenen, historisch gewordenen Epoche der Architekturentwicklung an. Angesichts vieler Verluste in den letzten Jahren kümmern sich die Denkmalpflege-Ämter generell vermehrt um den Bestand der 1980er-Jahre.

Kirchen in den DDR-Anfangsjahren
1950 gehörten etwa 85 Prozent der DDR-Bürger einer evangelischen und etwa 10 Prozent der katholischen Kirche an. Rund zwei Millionen aus dem Osten geflohene Katholiken mussten aufgenommen werden. Im sozialistischen Staat gab es praktisch keine Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen. Diese Aufgabe übernahmen die Kirchen. Die evangelischen Kirchen gaben „Asyl“.
In der DDR war das Verhältnis zwischen Staatsführung und Kirchen mal mehr, mal weniger angespannt, aber nie gut. Bis in die 1970er-Jahre, als Erich Honecker eine offenere Kirchenpolitik einläutete, wurde ein regelrechter Kampf gegen die Kirche geführt. Gläubige, die sich demonstrativ zu ihr bekannten, hatten wenig Chancen in dem SED-Staat. Jugendlichen Christen etwa wurde teilweise die Aufnahme in die Erweiterte Oberschule verwehrt. Gut gefüllte Kirchen und stark besuchte Kirchenfeste wurden schnell auch als Ausdruck des Unwillens gegenüber der SED wahrgenommen. Es bildete sich eine Subgesellschaft. Kirchenneubauten gab es, sogar in dreistelliger Zahl, sie bedeuteten aber mühevolle Unternehmen. Walter Ulbricht hatte in einer Rede 1953 über Kirchen als „bürgerlich-kapitalistische Verdummungseinrichtungen“ gesprochen und betont: „Wir brauchen keine weiteren Türme.“ Diese Aussage war durchaus wörtlich zu verstehen. Die Versammlungsräume der Gemeinden wurden in dieser Zeit meist in Einfamilienhäusern, Garagen oder sonstigen Gebäuden eingerichtet und sollten als Kirchen nicht erkennbar sein. Ein herausragender Turm, der sinnbildlich die Gläubigen an den rechten Ort leitet, womöglich noch mit Glockengeläut, war in diesen Fällen nicht denkbar – kreative Improvisation hieß das Gebot der Stunde.
Wenige der Architekten der neuen DDR-Kirchen sind namentlich ein Begriff, man baute offiziell als Kollektiv. Ulrich Müther bildet eine Ausnahme. Er gibt mittlerweile der Ost-Moderne – ein Thema, das zunehmend ins Bewusstsein rückt – ein Gesicht. Berühmt wurde er mit seinen Hyparschalen-Bauten. Mit der Rostocker Christuskirche erhielt er erstmals die Gelegenheit, einen Sakralbau zu betreuen. Vorausgegangen waren diesem Projekt, ähnlich wie bei so vielen anderen Kirchenneubauten in der DDR, „Stadtkorrekturen“ im Sinne des Sozialismus: Weil die alte neogotische Christuskirche, unter großen Anstrengungen nach dem Krieg wieder aufgebaut, angeblich einer geplanten Magistrale in den Süden der Stadt im Wege stand, wurde sie am 12. August 1971 trotz massiver Proteste gesprengt. Damit hatte man Rostocks Stadtsilhouette um eine weitere seiner prägenden Kirchen und somit von der Präsenz des Religiösen „bereinigt“. Zwei Monate zuvor war als Ersatz die neue Christuskirche geweiht worden – turmlos und in einer kleinen Seitenstraße. Die Magistrale wurde nie verwirklicht, das gigantische Bauvorhaben mangels finanzieller Mittel bereits 1970 eingestellt. Dass die als Zentralbau entworfene Kirche mit ihrem charakteristischen hyperbolischen und stützenfreien Dach unter Denkmalschutz steht, ist ihrem architektonischen, aber ebenso ihrem zeitgeschichtlichen Wert geschuldet.

„Das war mein schönstes Objekt, so etwas ist mir nie wieder passiert“, erzählt auch Peter Weeck 2015 in einem Gespräch mit einem der Autoren des Kirchenarchitekturprojekts „Straße der Moderne. Kirchen in Deutschland“. Er war als Architekt im Wohnungsbaukombinat Halle für gewöhnlich mit Wohnkomplexen beschäftigt. St. Gabriel in Leipzig-Wiederitzsch entwarf er 1970 als ein kleines Sakral-Kunstwerk aus Ziegelsteinen und Betonfertigteilen. Der Bildhauer Friedrich Press schmückte die backsteinernen Kirchenwände durch blickfangende Christusmotive und zeichnete für die gesamte Innenausstattung verantwortlich. Zusammen schufen sie einen katholischen Kirchenraum, bei dem die Behörden zu Recht befürchteten, er könnte zu einem heimlichen Wallfahrtsort avancieren. Entsprechend wurde er erst nach langjährigem bürokratischen Hickhack genehmigt. Der Trick, mit dem die Gemeinde von St. Gabriel ihren Entwurf schließlich durchbrachte, war das schlagende Argument des Holzmangels. Er machte die von oben befohlene Reparatur der bis dahin genutzten ungeliebten ehemaligen Wehrmachtsbaracken unmöglich. Ein ganzer Trupp Freiwilliger packte beim Bau mit an, darunter auch viele nicht aktive Gemeindemitglieder und sogar ausgetretene Katholiken. Engagement war zwar bei allen Kirchenbauprojekten in der DDR notwendig, aber in dieser Dynamik bemerkenswert.

Neue Kirchen für neue Städte
Über das eingangs beschriebene Sonderbauprogramm von 1972 hinaus konnte die evangelische Kirche 1978 Zusätzliches erreichen: Am 6. März fand ein einmaliges Treffen zwischen Erich Honecker und Kirchenvertretern statt, um in mühsamen Gesprächen zu einer beiderseitig akzeptablen Situation in der DDR zu kommen. Die evangelische Kirche hatte – ohne mächtigen Vatikan mit großem diplomatischen Einfluss im Rücken – eine eigene Rolle finden müssen. „Kirche im Sozialismus“ war ihr umstrittener Versuch, sich mit den staatlichen Gegebenheiten zu arrangieren. Der Staatschef hingegen erkannte, dass die beiden großen christlichen Konfessionen auch im sozialistischen Teil Deutschlands dank ihrer geistigen und finanziellen Kraft nicht auszuradieren waren. Ergebnis war unter anderem der bemerkenswerte Beschluss, den 500. Geburtstag Martin Luthers gemeinsam feierlich zu begehen, und ein genauso erstaunliches Bauprogramm: Am Rand der entstehenden riesigen Plattenbausiedlungen wurden Gotteshäuser und Gemeindezentren unter dem Motto „Kirchen für neue Städte“ geplant. Paradoxerweise, jedoch durch die allgegenwärtige Devisennot erklärbar, waren so in den sozialistischen Stadtentwürfen für den marxistisch-leninistisch geschulten, sprich den bedingungslos atheistischen Menschen Kirchen zu finden.
Es entwickelten sich Kirchenarchitekturen, die in Form und Material auffielen. Die durch den „Devisendeal“ mit den westlichen Kirchen erkauften Materialien wie Kupfer, Klinker und Fliesen waren in der DDR sonst absolute Mangelware. In den Formen orientierten sich die Kirchen am internationalen Sakralbau und den liturgischen Konzepten ihrer Zeit. Zentralbauten, polygonale Grundrisse, asymmetrische Fassaden und die Tendenz zu Gemeindezentren finden sich hier wie dort. Beton ist ein häufig verwendeter Baustoff.

Parallel zu den Kirchen aus dem staatlichen Sonderbauprogramm entstanden insbesondere auf dem Land auch in den 1970er- und 1980er-Jahren nach wie vor Kirchen unter stark erschwerten Bedingungen in Eigenleistung der Gemeindemitglieder und in Gebäuden, die nach außen kaum als sakrale Orte wahrnehmbar waren. Oft unterschied die Kirche am Ort nur ein unscheinbares Kreuz an der Hauswand von den umliegenden Wohngebäuden.
Trotz der schwierigen Umstände wurden laut Verena Schädler, die sich der Erforschung des katholischen Kirchenbaus in der DDR verschrieben und 2013 einen gewichtigen Forschungsband vorgelegt hat, zwischen 1945 und 1989 etwa 350 Sakralräume geweiht. Bei den wenigsten handelte es sich um reine Neubauten. Nach den Zugeständnissen Honeckers in den 1970ern wurden 55 katholische Kirchen, 34 davon in den Sonderbauprogrammen errichtet. Die evangelische Kirche realisierte in der Zeit etwa 35 Neubauprojekte.
„Eine Kirche mit Seltenheitswert“ lautet heute von denkmalpflegerischer Seite das Urteil über St. Gabriel in Leipzig. Wenn es auch einige qualitativ ansprechende Bauten dieser Art gibt, sind die Kirchen in ihrer Gesamtheit „weniger Beispiel einer ausgefallenen Architektur, sondern wichtige Denkmale der DDR-Kirchenpolitik“, wie es das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen formuliert. Was sie sicherlich darstellen: ein relativ unbekanntes, aber bedeutendes Kapitel aus der sakralen Kunstgeschichte.

Kirche im Sozialismus
Insbesondere, weil nicht nur der Anfang, sondern auch das Ende dieses Kapitels in die Weltgeschichte einging: Unter anderem ließen die atomare Aufrüstung in Ost und West und die Einführung des Wehrunterrichts als obligatorisches Schulfach in den 1980er-Jahren eine breite Friedensbewegung unter dem Motto „Schwerter zu Pflugscharen“ entstehen. Die Kirchen wurden mehr und mehr Versammlungsorte für systemkritische Gruppen und spielten während der Friedlichen Revolution mit ihren Montagsdemonstrationen, die schließlich das Ende der DDR einläuteten, eine entscheidende Rolle. Und das, obwohl der Anteil der Konfessionslosen an der Gesamtbevölkerung bis 1989 auf etwa 70 Prozent gestiegen war.
Auch die aufwendigen Feierlichkeiten zum 500. Geburtstag Martin Luthers 1983 hatten nicht die erwünschte Befriedung im Inneren und die Aufwertung der DDR im Ausland gebracht. Jahrelang als Fürstenknecht und Bauernfeind scharf kritisiert, war Luther nun zu einem umstürzlerischen Erneuerer im Sinne des marxistisch-leninistischen Menschenbilds uminterpretiert worden. Die restaurierte Wartburg wurde von Erich Honecker persönlich wiedereröffnet. Die meisten protestantischen Länder hatten trotzdem keine Vertreter zum Jubiläum geschickt. Ende 1983 wurde die Parole ausgegeben: „Es hat sich ausgeluthert.“ Doch für die Kirchen in der DDR war 1983 ein Jahr der Baugenehmigungen und des Materialnachschubs. Ein Lutherjubiläum, das in zahlreiche Kirchenbauten eingewirkt hat mit Entstehungsgeschichten, die es nicht zu vergessen gilt.
Beatrice Härig
Bartnings Notkirchen in der SBZ und DDR – Förderprojekte
der DSD
Noch vor Gründung der DDR lief in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) das Notkirchenprogramm der Evangelischen Kirche an und konnte mehr oder weniger ungestört arbeiten. Unmittelbar nach dem Krieg herrschte eine gewisse Neutralität in religiöser Hinsicht. 12 dieser relativ preiswerten Notkirchen entstanden auf dem Gebiet der SBZ und DDR, ermöglicht vom Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland, bei dem Gemeinden ein Gotteshaus beantragen konnten. Geheime Spendensammlungen fanden schon während des Krieges in den USA statt. Die Kirchen hatte Otto Bartning als Dreigelenk-Nagelbinder-Konstruktion entworfen, sie wurden als Bau-Set zur Selbstmontage geliefert. Die Raumschale mauerte man vor Ort mit lokal verfügbaren Baumaterial – nicht selten Trümmerziegel (s. a. der Artikel Otto Bartning und seine Kirchen hier)

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz förderte:
- Offenbarungskirche in Berlin-Friedrichshain, Bartning-Notkirche Typ B. 1949 geweiht
- Neue Kirche Wismar, Bartning-Notkirche Typ B, 1950/51 direkt neben der zerstörten Marienkirche errichtet. Im Altarbereich steht das Retabel des Passionsaltars aus St. Georgen. Es wurde kurz nach 1400 in einer Wismarer Werkstatt gefertigt, im Krieg ausgelagert und 1975 in der Neuen Kirche aufgestellt.

Literatur
Verena Schädler: Katholischer Sakralbau in der SBZ und in der DDR. Verlag Schnell & Steiner, Regensburg 2013. ISBN 978-3-7954-2675-0, 352 S. m. CD und Kartenmaterial, 39,95 €.
Ausstellung
Die Ausstellung „Otto Bartning (1883–1959): Architekt einer sozialen Moderne“ ist bis 18.6. in Berlin zu sehen: Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin.
Danach: Städtische Galerie Karlsruhe vom 22.7. bis 22.10. 2017 und Institut Mathildenhöhe Darmstadt 19.11.2017 bis 18.3.2018.
Tipp
Seit Sommer 2015 gibt es die Online-Ausstellung „Straße der Moderne“. Jeden Sonntag wird eine weitere Kirche des 20. oder 21. Jahrhunderts in Deutschland mit kurzen Texten und Plänen vorgestellt. Initiator des Projekts ist das Deutsche Liturgische Institut, Trier. www.strasse-der-moderne.de
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther 04.07.2017 Ulrich Müther Hyparschalen

Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Mittelalterliche Wandmalereien in Behrenhoff 16.01.2018 Die Hölle Vorpommerns Die Hölle Vorpommerns

In der Dorfkirche von Behrenhoff haben sich eindrucksvolle Darstellungen des Fegefeuers erhalten.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz