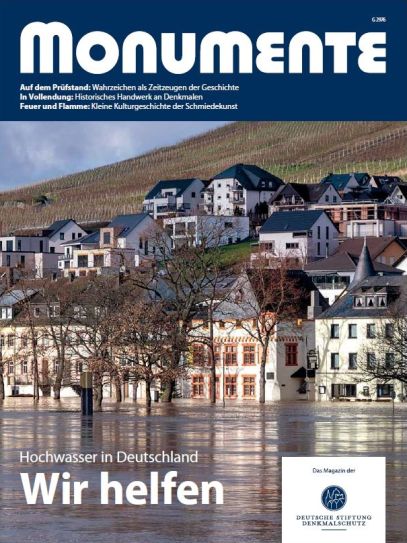April 2014 B
Die vergessene Geschichte der Ballhäuser
Vorteil: Herzog!
Vom 16. bis 18. Jahrhundert schmückten sich Reichsstädte, Residenzen und Universitäten mit Ballhäusern. Diese wurden allerdings nicht für Tanzveranstaltungen, sondern für einen Vorläufer des Tennisspiels errichtet. Bauliche Spuren dieser sportlichen Ära gibt es heute kaum noch.
Plopp, plopp, plopp, hallt es von den Mauern der Kirche. Der Punkt geht an den Abt! Den Kreuzgang eines spätmittelalterlichen Klosters verbinden wir mit Stille und Kontemplation. Leicht, sich Mönche vorzustellen, die ins Gebet versunken unter den Arkaden wandeln. Aber Kleriker, die mit der hohlen Hand kleine Bälle über den Klosterhof schmettern? Tatsächlich hatte das "Jeu de paume", das Spiel mit der Handinnenfläche, seinen Ursprung genau hier. Von den Klöstern Nordfrankreichs aus trat die frühe Form des Tennissports den Siegeszug durch Europa an und ließ in der Frühen Neuzeit eine neue Architekturgattung entstehen: das Ballhaus.
Den Ordensbrüdern war das Spiel wohl ebenso vertraut wie die Stundengebete. Selbst die Bischöfe und Erzbischöfe ergötzten sich daran. Seit dem 12. Jahrhundert sind Ballspiele hinter Klostermauern belegt. Dabei bewährte sich der Schlag mit der Hand, die mitunter durch einen Handschuh geschützt wurde.
Die Architektur der Kreuzgänge hatte erheblichen Einfluss auf die Spielregeln: Die Arkadenbögen fungierten als Tore, die es zu verteidigen galt. Bestimmte Öffnungen zu treffen, brachte Punkte ein, und beim Aufschlag wurde der Ball auf das abgeschrägte Dach der Galerie gespielt. Die erste bekannte bildliche Darstellung eines solchen Tennisplatzes stammt von einer französischen Handschrift aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.
Zur Verbreitung des Jeu de paume trugen sicher die Klosterschüler bei, die die neue Sportart zunächst in Paris bekannt machten. Über seine von Mönchen ausgebildeten Sprösslinge begeisterte sich auch der Adel für den neuen Zeitvertreib.
Dieser wurde zudem als gesundheitsfördernd angepriesen. Ganz in der Tradition der Antike waren Leibesübungen für die Humanisten ebenso wichtig wie die Bildung des Geistes. Der italienische Arzt und Gelehrte Hieronymus Mercurialis - eine Instanz unter den Medizinern der Renaissance - empfahl "Pallacorda", so die italienische Bezeichnung des Tennisspiels, weil es die Eleganz der Bewegungen sowie die Stärke von Armen und Beinen erhöhe. Seine ab 1573 publizierte Schrift "De arte gymnastica" gilt als erstes Standardwerk der Sportmedizin. Über den Nutzen des Ballspiels waren sich die Experten jener Zeit einig. Wie das Reiten, Fechten und Tanzen sei diese Körperübung bestens geeignet für das Mannesalter. Ab dem 50. Lebensjahr solle man sich allerdings eher auf Spaziergänge beschränken.
Ein weiterer Aspekt ließ das Jeu de paume für Personen von Stand attraktiv erscheinen: Nach damaligen Gepflogenheiten kam man beim Tennis ohne absurde Verrenkungen, Rennen und übermäßiges Schwitzen aus. Es tat also der Würde von Fürsten oder Kardinälen keinen Abbruch.
Als Spielstätten dienten rechteckige, von hohen Mauern umgebene Plätze, zunächst oben offen, später meist überdacht. Ausgehend von Frankreich und Italien entstanden ab der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts immer mehr Säle für das Jeu de paume. Ob in die Schlösser integriert oder freistehend im Park, gehörten Ballhäuser bald zu einem festen Bestandteil der europäischen Höfe und wurden bei Neubauten in die Planung mit einbezogen.
Die genauen Vorgaben für die Bauweise fanden Eingang in die Architekturlehrbücher. Die hohen Wände der schlichten, flachgedeckten Hallen bekamen einen schwarzen Anstrich, damit man die weißen Bälle gut erkennen konnte. Fenster, vor die Tücher oder Netze gehängt wurden, gab es nur im oberen Drittel. Auch die Zuschauerplätze in den seitlichen Galerien waren mit Netzen geschützt. Das wichtigste Element war das schräg vorkragende Dach, das der Angabe diente - eine Reminiszenz an das mittelalterliche Spiel der Mönche im Kreuzgang. Die Wände konnten zusätzliche Gewinnlöcher aufweisen. Der Boden war mit quadratischen Platten ausgelegt: Anhand der Linien wurde die Stelle des Ballaufsprungs gemessen, die in die Wertung einging. Eine Schnur mit Fransen, später ein Netz, teilte den Platz in zwei Hälften. Auch wenn das Jeu de paume seinen Namen behielt, verwendete man nach 1500 mit einem Netz bespannte Schläger.
Der Hochadel ging mit sportlichem Beispiel voran: König Franz I. (1515-47) förderte den Ballhausbau in Frankreich, Heinrich VIII. (1509-47) tat es ihm in England nach: Der humanistisch gebildete Tudor-König wünschte sich Tennisanlagen in allen Schlössern, engagierte einen persönlichen Trainer und ließ sich spezielle Tenniskleidung auf den damals noch athletischen Leib schneidern. Auch die Wiener Hofburg erhielt durch den Erzherzog und späteren Kaiser Ferdinand I. in den 1520er-Jahren das erste von vier Ballhäusern. Für Kaiser Maximilian II. errichtete Hofarchitekt Bonifaz Wohlmuth 1567-69 im Königlichen Garten auf dem Prager Hradschin ein besonders prachtvolles, mit reichen Sgraffiti verziertes Ballspielgebäude.
In der Tradition der Ritterturniere gehörten sportliche Wettkämpfe bei königlichen Gipfeltreffen zum Rahmenprogramm. Bei seinem Besuch in England 1522 lieferte sich Kaiser Karl V. mit König Heinrich VIII. im Londoner Bridewell Palace ein hitziges Tennis-Match. In Augsburg errichtete man anlässlich des Reichstages von 1548 eilig ein Ballhaus, das spanische Teilnehmer wohl ausdrücklich eingefordert hatten.
Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts hielt das Jeu de paume an deutschen Fürstenhöfen Einzug. Auf der Burg Trausnitz in Landshut hatte sich der junge Wittelsbacherprinz, der spätere Herzog Wilhelm V. von Bayern, 1568 von seinem Vater "ein kleines Ballspiel" erbeten. Dafür wurde das alte Brauhaus im äußeren Schlosshof umgebaut. Nach bescheidenen Anfängen perfektionierte Wilhelm den Zeitvertreib: Die Bälle wurden aus dem Ausland importiert, ein Trainer aus Lothringen eingestellt. 1577 ließ er sich ein ganzes Ballhaus in Einzelteile zerlegt aus Innsbruck kommen, damit man in Landshut dessen vorbildliche Konstruktion studieren konnte. Vom Vater wurde die Kurzweil kritisch beäugt. Albrecht V. befürchtete, der Sohn würde über dem vielen Ballschlagen seine Pflichten oder gar den Gottesdienst vergessen.
Eine ganz andere Ansicht vertrat Landgraf Moritz von Hessen-Kassel in seiner Hofordnung von 1605: Gesunde Sportarten wie Reiten, Fechten, Tanzen, Schießen und Ballschlagen schienen ihm geeignet, den jungen Adel "von allerhandt müssiggang, spilen umb geldt, sauffen und andere nichtswirdige unordnunge" abzuhalten. Den Bau von Ballhäusern verfügte der Calvinist als Erziehungsmaßnahme.
Der pädagogische Nutzen der Leibesübungen schlug sich in den Schulordnungen nieder. An Gymnasien und Universitäten gehörte das Schlagen des kleinen Balls zu den erwünschten Spielen. Vor allem an den im 17. Jahrhundert etablierten Ritterakademien - Bildungsanstalten zur höheren Erziehung des Adels - legte man allergrößten Wert auf die kavaliersmäßigen Exerzitien. Umfangreiche Sportanlagen waren fester Bestandteil einer solchen Institution. Zu den renommiertesten Adelsschulen in Europa zählte das 1594 eröffnete Collegium illustre in Tübingen.
Während die Studenten ihre Vorlesungen in Mathematik, Geschichte, Sprachen und Politischen Wissenschaften frei wählen durften, war die Teilnahme an den Leibesübungen, darunter das Ballschlagen, verpflichtend. Der Tennis- und Tanzmeister - in Tübingen ein und dieselbe Person - verdiente sogar mehr als ein Professor für Geschichte oder Recht.
Das Sportangebot der Universitäten und Ritterakademien hatte auch einen wirtschaftlichen Aspekt: Nur mit gut ausgestatteten Hallen und entsprechendem Personal konnte man Studenten aus den besten Familien anlocken. Der Rektor des Tübinger Collegium illustre gab um 1606 eine Werbeschrift heraus, die unter anderem mit einem Kupferstich des Ballhauses bestückt war. Als 1670 die Universität Jena ein Ballhaus bekommen sollte, unterstrich der Senat die Notwendigkeit, "da die von Adel und andere bemittelte Studiosi öfters nicht sowohl des studierens halber, als der Exerzitien wegen die Universität besuchen".
Zunächst waren die Tennishallen vor allem im süddeutschen Raum verbreitet, im Lauf des 17. Jahrhunderts setzten sie sich auch im Norden immer mehr durch. Für eine Reichs-, Residenz- oder Universitätsstadt war ihre Einrichtung unverzichtbar geworden. Unternehmer unterhielten kommerzielle Ballhäuser, die von zahlungskräftigen Bürgern angemietet werden konnten. Dennoch reichte keine andere Nation an Frankreich heran. Der englische Reiseschriftsteller Robert Dallington witzelte 1604 darüber, dass die Franzosen mit einem Schläger in der Hand geboren würden und dass es in dem Land mehr Ballspielplätze als Kirchen gäbe. Die unangefochtene Tennismetropole der Frühen Neuzeit blieb Paris - die Stadt soll geradezu gepflastert gewesen sein mit Ballhäusern.
Mit dem Aufschwung des Jeu de paume hatte sich ein neuer Berufsstand etabliert: Die Ballmeister fungierten als Trainer und Schiedsrichter, waren für die Instandhaltung der Anlage verantwortlich, stellten Schläger, Bälle und manchmal Kleidung, wiesen die Balljungen ein und hielten Erfrischungen parat. Oft mussten sie die Bälle und Schläger selbst anfertigen. Die ersten "ballenmeister" auf deutschen Tennisplätzen waren aus dem Mutterland des Jeu de paume eingewanderte Hugenotten. In Frankreich hatten die "paumiers", die eine dreijährige Lehre absolvierten, ab 1610 sogar ihre eigene Zunft. Als fürstliche oder akademische Ballmeister konnten sie es auch hierzulande zu hohem Ansehen bringen. Der Nürnberger Ballmeister Johann Georg Bender verfasste 1680 das erste deutsche Tennislehrbuch: "Kurtzer Unterricht deß lobwürdigen, von vielen hohen Stands-Personen beliebten Exercitii deß Ballen-Spiels".
Nicht nur der Unterricht konnte ein einträgliches Geschäft sein, mit dem Zubehör ließ sich ebenfalls trefflich handeln. Ein Geschäftsmann wie Hans Fugger war weitsichtig genug, auch diese Sparte zu bedienen: Über Jahre versorgte er die Bayern-Herzöge mit "Ragetten" und Bällen - mal aus Paris, mal aus Neapel oder Flandern.

Ohne Geld lief beim Tennis ohnehin nichts. Auch die Sportwette war schon erfunden. Man spielte um beträchtliche Summen, und in den Ausgabenbüchern der Fürsten waren Spielschulden ein fester Posten. Der Schritt zu unlauteren Geschäften war nicht allzu groß. Spieler beschwerten sich über raffgierige und bestechliche Ballmeister, die zu hohe Gebühren verlangen oder bewusst falsch zählen würden. In den öffentlich zugänglichen Ballhäusern nahm das Glücksspiel überhand, Trinkgelage und Raufereien waren an der Tagesordnung. Mancherorts schien das Ballhaus zu einem Hort für Kleinkriminelle verkommen zu sein. Der einst so galante Zeitvertreib, der die Gesundheit erhalten und einen wachen Geist fördern sollte, geriet in Verruf.
Als schließlich auch der Adel das Interesse am Tennis verlor, war der Niedergang der Ballhäuser besiegelt. Bei Hofe hatte man im 18. Jahrhundert längst eine neue Leidenschaft entwickelt: das Theater. Die Sporthallen ließen sich dank ihrer stattlichen Ausmaße leicht zu Theater- oder Festsälen umfunktionieren. Ein prominentes Beispiel für die Verwandlung eines Ballhauses in eine bis heute bestehende Schauspielstätte ist das Ekhof-Theater in Gotha. Als das Herzogshaus Sachsen-Gotha ab 1643 Schloss Friedenstein errichten ließ, wurde in den beiden unteren Geschossen des Westturms ein Ballhaus eingerichtet. Bereits 1681 veranlasste Herzog Friedrich I. den Umbau zum herzoglichen Komödienhaus. Ab 1775 gelangte das Gothaer Hoftheater unter der Leitung von Conrad Ekhof mit einem eigenen Ensemble zu großer Blüte.
In Passau, Hannover oder Hildburghausen haben Theatergebäude dieselbe Vorgeschichte. Das Ballhaus des Bückeburger Schlosses wurde Ende des 18. Jahrhunderts zur Reithalle erklärt und blieb zumindest als Sportstätte bestehen. Den akademischen Einrichtungen erging es nicht anders. In Marburg zog um 1775 kurzzeitig das "Theatrum anatomicum" ein, 1781 legte man das mittlerweile baufällige Bauwerk nieder. Dieses Schicksal traf die meisten Ballhäuser: Sie wurden, nachdem das Spiel aus der Mode gekommen war, schlicht abgerissen.
Die frühe Tennis-Ära hat in Deutschland kaum bauliche Spuren hinterlassen. Hinweise liefern allenfalls Straßennamen wie Ballhausgasse. Die meisten denken dabei wohl an einen Tanzsaal. Dabei haben die beiden gleichlautenden Begriffe sprachgeschichtlich gar nichts miteinander zu tun. Im 19. Jahrhundert behauptete sich das aus dem Italienischen und Französischen entlehnte Wort für die festliche Tanzveranstaltung - "il ballo", "le bal".
In anderen Ländern gibt es immerhin noch vereinzelte Zeugen des frühen Hallentennis. Im Royal Tennis Court von Hampton Court Palace, 1526-29 errichtet, wird sogar bis heute gespielt. Schloss Neugebäude in Wien-Simmering - unter Maximilian II. 1569 begonnen, aber nie vollendet - besitzt ein imposantes Ballhaus. Der Renaissancebau auf der Prager Burg besteht als Konzert- und Ausstellungshalle fort; in der Galerie nationale du Jeu de Paume in den Pariser Tuilerien, neu errichtet unter Napoléon III., wird zeitgenössische Kunst gezeigt.
Die Tennishalle von Versailles ist ebenfalls als Museum erhalten geblieben - nicht, weil man hier Sportgeschichte, sondern Weltgeschichte schrieb. Mit dem Ballhausschwur vom 20. Juni 1789 wurde das Gebäude zu einem besonderen Denkmal der Französischen Revolution. Nachdem Ludwig XVI. den Abgeordneten des Dritten Standes den Zugang zu ihrem Sitzungssaal im Schloss verwehrt hatte, versammelten sie sich im Ballhaus und schworen, nicht ohne Verfassung auseinanderzugehen. So wurde die alte Ständeordnung ausgerechnet an einem Ort gekippt, der dem exklusiven Zeitvertreib der Oberschicht vorbehalten war.
Bettina Vaupel
Literatur:
Wolfgang Behringer: Kulturgeschichte des Sports. Vom antiken Olympia bis ins 21. Jahrhundert. Verlag C. H. Beck, München 2012.
ISBN 978-3-406-63205-1, 494 S., 24,95 Euro. Heiner Gillmeister: Kulturgeschichte des Tennis. Wilhelm Fink Verlag, München 1990 (antiquarisch erh.)
Weitere Infos:
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther 04.07.2017 Ulrich Müther Hyparschalen

Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
-
Mittelalterliche Wandmalereien in Behrenhoff 16.01.2018 Die Hölle Vorpommerns Die Hölle Vorpommerns

In der Dorfkirche von Behrenhoff haben sich eindrucksvolle Darstellungen des Fegefeuers erhalten.
-
Von Seekisten und Seeleuten 08.11.2012 Seekisten Was auf der hohen Kante lag

In den alten Zeiten der Frachtsegler musste die gesamte Habe des Seemanns in eine hölzerne Kiste passen. Manchmal liebevoll bemalt, war sie das einzige persönliche Stück, das ihn auf seinen Reisen über die Weltmeere begleitete.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
Lesen Sie 2 Kommentare anderer Leser
-
 Prof. Hardy Fischer schrieb am 21.03.2016 15:58 Uhr
Prof. Hardy Fischer schrieb am 21.03.2016 15:58 UhrSehr geehrte Frau Vaupel,
Auf diesen Kommentar antworten
schade, in Ihrem Artikel nicht das Ballhaus im Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe erwähnt zu finden.
Das Kasseler Ballhaus hat den umgekehrten Weg genommen vom Hoftheater (Arch. Leo Klenze) zum Ballsaal (Arch. J.C. Bromeis) und schließlich doch zum Ballhaus. Dafür sorgte in der finalen feudalen Zeit Kaiser Wilhelm Zwo. Um 1900 benutzten die Kaisers das Ballhaus ihrer Kasseler Sommerresidenz für das gemeinsame Tennisspiel: Ball bleibt Ball.
Nach 1945 amerikanisches Militärcasino und Speisesaal, dann Lager, erstrahlt es nach grundlegender Sanierung seit 1986 als Ausstellungssaal und gelegentlicher Versammlungsraum der Museumslandschaft Hessen Kassel.
Es ist einer der wenigen repräsentativer Räume, die auf der Wilhelmshöhe den Zerstörungen durch Bomben und Birnen (Neugestaltung durch Abriss) in etwa unbeschadet überstanden haben.
Mit meinen guten Wünschen
Prof. Hardy Fischer
Bürger für das Welterbe e.V.
Kassel -
 Reiner Kaminski schrieb am 21.03.2016 15:58 Uhr
Reiner Kaminski schrieb am 21.03.2016 15:58 UhrDie Veränderung der Bedeutung des Begriffs Ballsaal ist ja geradezu fantastisch. Würde man Ballsäle nach heute gängiger Bedeutung Tennishallen nennen, wäre die Verwirrung komplett.
Auf diesen Kommentar antworten
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz