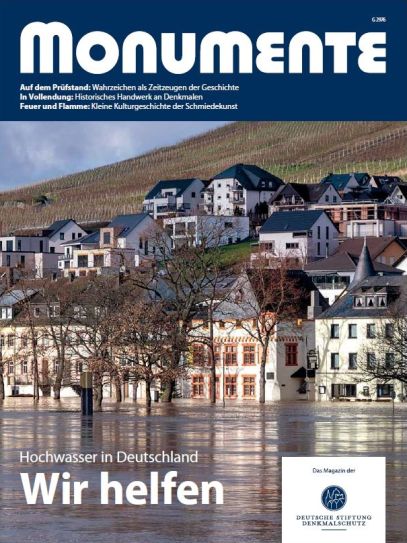August 2013
Die Villa Kneiff in Nordhausens Park Hohenrode braucht Hilfe
Kein Zimmer mit Aussicht
Der 1871 vom Tabakfabrikanten Carl Kneiff angelegte Park Hohenrode ist seit langem ein beliebter Ort der Erholung für die Bürger Nordhausens. Engagierte Eherenamtliche bemühen sich um die Rettung der denkmalgeschützten, aber desolaten Villa Kneiff, die der zeitgleich errichtete Mittelpunkt des Parks ist.
Ein Hohlweg weist den Weg zur Villa Kneiff. Tief ausgefahrene Spuren führen unter einer steinernen Brücke hindurch den Hang hinauf und enden mitten im Park Hohenrode auf einem von Bäumen umstandenen Vorplatz. Ein Bauwagen steht der großen Eingangstür gegenüber. Das Entree zu der stattlichen Villa aus dem 19. Jahrhundert flankiert ein Bauzaun, ein Gerüst umfängt das Gebäude. Aus dem Hausinneren ist Hämmern zu hören. Die Fenster der Villa sind mit Platten verbarrikadiert oder zugemauert. Zersplitterte Glasscheiben, abgebrochene Balustraden und besprühte Mauern zeugen von Vandalismus.
Ein junges Paar kommt aus dem Gebäude. Katja und Reno heiraten bald und sind trotz des Bauzustandes vom Ambiente der Villa Kneiff äußerst angetan. "Besonders die Halle mit der Lichtkuppel und das Treppenhaus sind wunderschön. Für unsere Hochzeitsfotos geradezu ideal!" schwärmt die junge Frau. "Wir feiern eine Vintage-Hochzeit im viktorianischen Stil, und die Villa mit ihrem morbiden Charme passt großartig dazu." Gisela Hartmann, die in einer Person den Vorstand der Bürgerstiftung Park Hohenrode Nordhausen und den Vorsitz des Fördervereins Park Hohenrode e. V. repräsentiert, ist innerlich zwiegespalten: Einerseits freut es sie sehr, dass bei den Bürgern von Nordhausen die Villa Kneiff immer noch so bekannt ist und geschätzt wird, auf der anderen Seite wünscht sie sich, Besucher würden nicht auf ein solch heruntergekommenes Gebäude in dem schönen, aber pflegebedürftigen Park treffen.
Denn eigentlich handelt es sich bei dem Kneiff'schen Anwesen um ein Juwel. Der zehn Hektar große Landschaftspark ist mit der Villa, dem Kutscherhaus und einem Gartenpavillon als Einheit nahezu unverändert erhalten. Für Thüringen ist dies trotz seiner zahlreichen Parkanlagen und Residenzen eine Rarität.
Die Schöpfer des beeindruckenden Ensembles waren die Tabakfabrikanten Carl Kneiff (1829-1902) und sein Sohn Fritz (1864-1944). Neben dem Beruf teilten sie eine Leidenschaft: Sie sammelten begeistert Gehölzarten, die Parkanlage mit den unterschiedlichsten, teils seltenen Bäumen und Strauchsorten war ihr ganzer Stolz. Beide waren Mitglieder der 1892 ins Leben gerufenen Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, die sich dem Erhalt, der Pflege, der Pflanzung und Verbreitung von Bäumen und Sträuchern widmet.
1874 erwarb Carl Kneiff das Grundstück im grünen Naherholungsgebiet Nordhausens und beauftragte zwei Koryphäen ihres Fachs mit der Planung von Villa und Park. Für sein Wohnhaus, das Kutscherhaus und einen Pavillon gewann er den Architekten Ludwig Bohnstedt. Dieser war damals in Gesellschaftskreisen sehr gefragt, besonders nachdem ihm 1872 der erste Preis für den Entwurf des Reichstagsgebäudes in Berlin verliehen worden war. Für die Gestaltung des Landschaftsparks holte Kneiff den bekannten Gartenkünstler Heinrich Siesmayer nach Nordhausen, der in seiner Schaffenszeit für Hunderte von Grünanlagen in privater und öffentlicher Hand verantwortlich zeichnete, unter anderem für den Kurpark von Bad Nauheim (1850) und den Palmengarten in Frankfurt am Main (1868-71).
Die Entwürfe von Architektur und Park ergänzen sich in kongenialer Weise. Bohnstedt orientierte sich an der italienischen Villenarchitektur der Renaissance. Er schuf ein zweigeschossiges Gebäude auf einem Rustikasockel, das an den Hauptfassaden durch Mittelrisalite betont und von einem Mezzaningeschoss mit flachem Zeltdach abgeschlossen wird. Um die Räume in dem großen, fast quadratischen Baukörper zu belichten, fügte er in die Mitte einen Lichthof ein, der von runden Glasdecken überkuppelt wird. Der Hanglage entsprechend zeigt das Gebäude seine repräsentative Schauseite nach Süden. Das an dieser Seite mannshohe Rustika-Kellergeschoss zog Bohnstedt für eine großzügige Terrasse mit Freitreppe vor. Ein im Osten angebauter Wintergarten gab der kompakten Villa eine auflockernde Note.
Entsprechend legte Heinrich Siesmayer vor der südlichen Garten- und der nördlichen Eingangsseite zwei Wiesenflächen an, die mit geschickt komponierten Gehölzgruppen eigene Gartenräume bilden. Eine ausgefeilte Wegeführung, in deren Zentrum die Villa lag, Bodenmodellierungen und Gehölzpflanzungen bestimmen Siesmayers Landschaftspark, der neben den verschiedenen Baumarten interessante Ein- und Ausblicke bot. Der Gartenkünstler bevorzugte einheimische Gehölze, Carl Kneiff fügte im Laufe der Jahrzehnte die exotischen, unbekannteren Arten hinzu. Dieses gelungene Zusammenspiel führten die Nachfolger Fritz Kneiff und Philipp Siesmayer (1862-1935) ab 1910 weiter, nachdem das Parkareal durch -Zukäufe vergrößert worden war.
Mit dem Tod Fritz Kneiffs 1944 endete die Ausgestaltung des Parks. Trotz der schweren Kriegszerstörung Nordhausens blieb er erstaunlicherweise verschont. Seit den 1960er Jahren für Besucher frei zugänglich, bietet das 1975 unter Denkmalschutz gestellte Ensemble nicht nur Spaziergängern Erholung, auch Gartenexperten haben hier ein Anschauungs- und Forschungsfeld erster Güte. Das bemerkenswerte Arboretum wies über 400 Gehölze auf. So war es ein herber Schlag, als 1980 ein Orkan dort eine Schneise der Verwüstung hinterließ. Immerhin konnten mehr als 200 verschiedene Baum- und Straucharten gerettet werden. Die Parkpflege wurde in den vergangenen 50 Jahren von engagierten Menschen aufrecht erhalten, die von der Stadt Nordhausen, dem thüringischen Landesdenkmalamt und dem Kulturbund mit Fachberatung und wenigen, aber notwendigen Mitteln unterstützt wurden.
Auch die Villa ist in ihrer Bauform nahezu unverändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Tabakunternehmen der Kneiffs enteignet, doch das Anwesen in Hohenrode blieb bis vor drei Jahren in Familienbesitz. Von 1954 bis 1990 war die Villa an ein Frauen-Internat der Nordhausener Fachschule für Lehrerfortbildung vermietet. Mit dem folgenden Leerstand und dem Tod des letzten Alleinerbens geriet sie in Verfall, auch das Schicksal des Parks war mit einem Mal sehr ungewiss.
Dies tatenlos mitanzusehen, war nicht die Sache von 34 Nordhäusern: Sie gründeten 2005 den Förderverein. 2010 errichteten einige Mitglieder sowie zwei weitere Stifter die rechtsfähige Bürgerstiftung, um Park Hohenrode von der Erbengemeinschaft für 150.000 Euro kaufen zu können. Mit vereinten Kräften, fünf von der Nordhausener Arbeitsagentur vermittelten Bürgerarbeitern, zehn Bundesfreiwilligendienstlern sowie dem Beistand von Pflanzenexperten wird der Park gepflegt, Totholz beseitigt, werden Baumkronen geschnitten und die Wege freigehalten, damit die originale Struktur nicht untergeht. Allein die großflächige Beseitigung der wuchernden, giftigen Herkulesstaude hat die letzten zwei Jahre in Anspruch genommen.
All dies ist ein recht eingespieltes Unterfangen. Die Restaurierung der Villa hingegen zehrt an den finanziellen Kräften. Die größte Herausforderung ist neben der Instandsetzung des Dachstuhls die Bekämpfung des Echten Hausschwamms. Aufgrund des schadhaften Daches konnte er sich in dem durchfeuchteten Holz ausbreiten. Ein entscheidendes Etappenziel für eine erfolgreiche Restaurierung wäre, den zu zwei Dritteln sanierten Dachstuhl und die Dachdeckung fertigzustellen.
Wenn Gisela Hartmann durch die Villa geht, wandert ihr Blick über die Baustellen, registriert, wo es vorangeht und wo es stockt. Untätig sein kann sie auf keinen Fall. Während sie von den verschiedenen Kooperationsverträgen für die zukünftige Nutzung des Parks erzählt - er soll der Erholung dienen und auch in Zusammenarbeit mit dem benachbarten Südharz-Klinikum und dem Therapie-Verein Schattenkinder genutzt werden -, zieht sie mit geübten Handgriffen großflächig fleckige Tapetenbahnen aus Internatszeiten ab. "Sehen Sie, es geht ganz leicht. Da schafft man viel am Tag, aber leider nur wegen der Grundfeuchtigkeit in den Wänden", seufzt sie. Gisela Hartmann ist die Seele und treibende Kraft vom Villenpark Hohenrode, wie sie das Kneiff'sche Anwesen gern nennt. Sie ist allzeit präsent, arbeitet mit. Es ist der Kreis- und Stadträtin anzumerken, dass es für sie kein Aufgeben gibt, so strapaziös es auch ist. Aber nicht allein ihr Herz schlägt für Hohenrode. Mittlerweile sind es 413 Vereinsmitglieder, unter ihnen der Violinist Florian Sonnleitner, der dem Förderverein nach einem Benefizkonzert in der Villa beitrat.
Der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ist Gisela Hartmann zutiefst dankbar. Bereits bei der Notsicherung stand sie zur Seite "Man müsste einen riesigen Sack voller Geld zur Verfügung haben, und dann mit vielen denkmalerfahrenen Handwerkern hier durchgehen. Wie bald wäre die Villa wieder eine Perle und könnte genutzt werden. So aber machen wir Schritt für Schritt unverdrossen weiter." Quietschend lässt sich ein großer Fensterladen öffnen. Wie schön der Blick in die mit Kunstsinn gestaltete Natur ist - wie bezaubernd alle Blicke vom Haus in die Parkidylle sein könnten.
"Wir stehen auf den Schultern von Riesen", sagt die Vorsitzende. Mit dem Anspruch, dem Gesamtkunstwerk der Kneiffs, des Architekten Bohnstedt und der Landschaftsgärtner Siesmayer gerecht zu werden, haben sie und ihre Mitstreiter sich ein hohes, unterstützenswertes Ziel gesteckt - getragen von ihrem praktischen, erdverbundenen Engagement.
Christiane Rossner
Der Park Hohenrode liegt im Norden von 99734 Nordhausen. Eine Zugangstreppe befindet sich am Beethovenring/Ecke Wallrothstraße, dort gibt es auch einen Parkplatz.
Weitere Infos im WWW:
www.parkhohenrode.deDiese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Mittelalterliche Wandmalereien in Behrenhoff 16.01.2018 Die Hölle Vorpommerns Die Hölle Vorpommerns

In der Dorfkirche von Behrenhoff haben sich eindrucksvolle Darstellungen des Fegefeuers erhalten.
-
Die neue Lust am Bungalow 08.11.2012 Bungalows Die Leichtigkeit des Steins

Fast 17 Millionen Dollar. Das ist auch für das Auktionshaus Christie's keine alltägliche Summe. Bei 16,8 Millionen Dollar ist im Mai bei einer Auktion in New York für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst der Zuschlag erfolgt, und zwar für - und das ist ebenso ungewöhnlich - ein Bauwerk. Nicht einmal ein besonders großes.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
Lesen Sie 2 Kommentare anderer Leser
-
 Katja & Reno Grothe schrieb am 21.03.2016 15:54 Uhr
Katja & Reno Grothe schrieb am 21.03.2016 15:54 UhrDie Hochzeitsfotos, die wir am 20.07.2013 in der Villa und im Park machen durften, sind traumhaft schön geworden. So, wie wir es uns vorgestellt haben. Natürlich sind wir beide nun auch Mitglieder des Fördervereins und freuen uns, dass wir dazu beitragen können, die Villa wieder herzustellen, wenn unserer Beiträge auch nur wie Tropfen auf den heißen Stein wirken. Heute war der Tag des offenen Denkmals und es waren wirklich sehr viele Besucher im Park. Ich denke, es haben sich noch viele Menschen gefunden, die etwas dafür tun wollen, diese wunderschöne Villa mit ihrem tollen Park zu erhalten und dem Förderverein als Mitglied beigetreten sind.
Auf diesen Kommentar antworten
Mit lieben Grüßen aus Nordhausen
Reno & Katja -
 Kaiser, Rosemarie schrieb am 25.09.2020 18:00 Uhr
Kaiser, Rosemarie schrieb am 25.09.2020 18:00 UhrIch bewohnte von 1954 - 1956 die Villa Kneiff als Schülerin des Instituts für
Auf diesen Kommentar antworten
Lehrerbildung und dachte mir damals bereits: "Was muss das früher einmal
für ein Herrliches Haus gewesen sein." Den wunderschönen Park benutzten
wir gern zur Erholung. Ich beteilige mich sehr gern mit einer kleinen Spende
am Wiederaufbau der Villa Kneiff.
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz