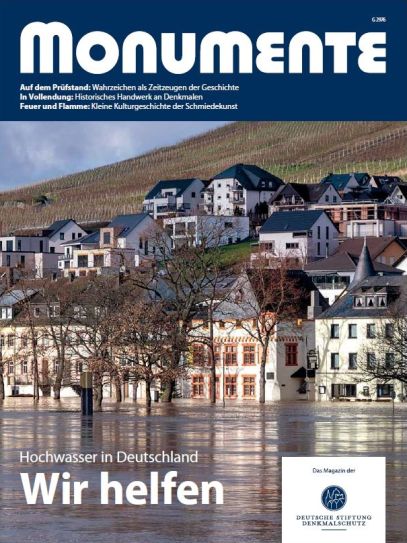Kurioses Material Handwerk August 2012
Reiche Schnitzereien am Eulenspiegelhaus in Osterwieck
Fachwerk vom Feinsten
Das Auge kann sich im Harzstädtchen Osterwieck gar nicht sattsehen an den vielen prächtigen Fachwerkfassaden. Die meisten der reich verzierten Häuser stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Sie haben den Dreißigjährigen Krieg und den großen Stadtbrand des Jahres 1884 überstanden.
Auch der Zweite Weltkrieg bescherte keine Verluste. Die waren erst später zu beklagen, als der DDR-Staat nicht genügend Material für notwendige Reparaturen bereitstellte. Holz war knapp und wurde daher selten bewilligt. Und die Denkmalbrigade Osterwieck, die sich eigentlich um die Sanierung der Baudenkmale kümmern sollte, wurde häufig für Arbeiten in Magdeburg und Halberstadt abgezogen. So konnte es passieren, dass selbst so wertvolle Gebäude wie das Eulenspiegelhaus in der Schulzenstraße zu verfallen drohten.
Auf einer Stadtverordnetenversammlung wurde 1968 festgestellt, dass das Haus abbruchreif sei und es sich nicht lohne, "hier auch nur eine Mark zu investieren". Die Mitarbeiter des Instituts für Denkmalpflege protestierten erfolgreich dagegen, denn es gibt in Sachsen-Anhalt wenige Fachwerkhäuser mit so reichen Schnitzereien.
Man vermutet, dass die Fassade des um 1530 errichteten Hauses von dem Holzschnitzmeister Simon Stappen geschaffen wurde, der ab 1517 vor allem in Braunschweig tätig war. Von ihm stammt das dortige Huneborstelsche Haus, aber auch das sogenannte Brusttuch in Goslar. Die Schnitzereien dieser Häuser ähneln denen am Eulenspiegelhaus.
An der Fassade ist auch die Osterwiecker Wappenrose zu erkennen, denn das Gebäude wurde zunächst als kleines Ratsstübchen genutzt. Neben allerlei Tier- und Fabelwesen erkennt man Ornamente sowie einen Mann, der einen Becher hält, und eine Schere, die darauf hinweisen könnte, dass sich im Eulenspiegelhaus die Gewandschneidergilde traf. Seinen Namen erhielt es vermutlich durch die Darstellung eben jener Schere, einer Eule und eines Narren - der Legende nach soll Till Eulenspiegel als Schneidergeselle gearbeitet haben.
Nach dem Protest der Denkmalpfleger in den 1960er Jahren wurden die größten Schäden am Gebäude durch die Denkmalbrigade Osterwieck beseitigt. Damals hob man die figürlichen Schnitzereien farbig hervor, obwohl es dafür keinen historischen Beleg gab. Da auch bei späteren Untersuchungen nur wenige Farbspuren auf den Schnitzereien festgestellt wurden, hat man sich bei der Sanierung 2003-2005 an die historischen Vorgaben gehalten. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beteiligte sich damals an der Restaurierung der Fenster mit 10.000 Euro. So wurde eines der schönsten und ältesten Fachwerkhäuser Osterwiecks erhalten.
Carola Nathan
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Die neue Lust am Bungalow 08.11.2012 Bungalows Die Leichtigkeit des Steins

Fast 17 Millionen Dollar. Das ist auch für das Auktionshaus Christie's keine alltägliche Summe. Bei 16,8 Millionen Dollar ist im Mai bei einer Auktion in New York für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst der Zuschlag erfolgt, und zwar für - und das ist ebenso ungewöhnlich - ein Bauwerk. Nicht einmal ein besonders großes.
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther 04.07.2017 Ulrich Müther Hyparschalen

Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
Lesen Sie 1 Kommentar anderer Leser
-
 Dr. Klaus Thiele schrieb am 21.03.2016 15:17 Uhr
Dr. Klaus Thiele schrieb am 21.03.2016 15:17 UhrMit dem Thema "Holz" ist das Motto des diesjährigen Tags des Offenen Denkmals an Kürze kaum zu übertreffen, dagegen ist die Fülle und Vielfalt dessen, auf die es aufmerksam machen will, umso größer. Eine historische Fachwerkstadt wie Osterwieck, in der Holz noch heute das Stadtbild prägt, bietet sich deshalb am 9. September in ganz besonderer Weise an, auf die Bedeutung hinzuweisen, die Holz durch viele Jahrhunderte hindurch nicht nur als Baumaterial sondern auch als Medium künstlerischen Gestaltens und Spiegelbild menschlicher Kultur gehabt hat.
Auf diesen Kommentar antworten
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz