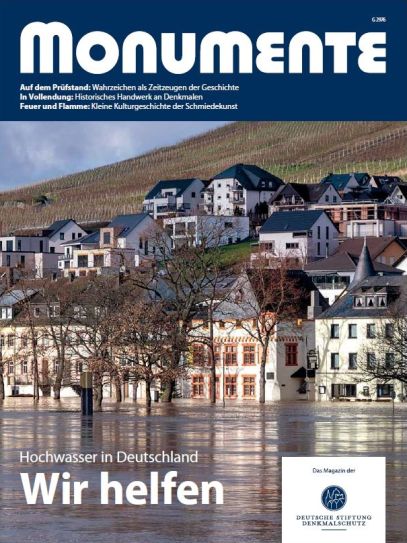Sehen und Erkennen Gotik Handwerk Oktober 2005 W
Kühne Konstruktionen der Gotik
Die hohe Kunst des Wölbens
Der Wiederaufbau der Wismarer Georgenkirche war 2001 schon weit fortgeschritten. Von außen sah sie fast fertig aus, hatten doch alle Bauteile mit Ausnahme des Turmes wieder ein Dach. Aber für die Bauleute begann nun eine besonders spannende Phase: Die zerstörten Gewölbe sollten wieder eingebracht werden. Dies geschah selbstverständlich mit den traditionellen Materialien Backstein und Kalkmörtel. Die alte Technik des Wölbens aber musste von den Baumeistern erst erprobt und von den Handwerkern wieder erlernt werden.
Als Erstes galt es, die drei schwer beschädigten Kreuzrippengewölbe des Chores zu stabilisieren, in die herabstürzende Ankerbalken des Dachstuhls große Löcher geschlagen hatten. Man musste jederzeit den Einsturz befürchten, weil die Kappen nur solange halten, wie sich die miteinander verzahnten Backsteine gegenseitig abstützen. Zum Glück gelang dieses schwierige Rettungsvorhaben, ohne dass Menschen zu Schaden kamen. Man hatte allerdings die Arbeiter nur von oben aus gesicherter Position wirken lassen. Als jedoch ein Stein auf ein benachbartes Gewölbe im südlichen Seitenschiff des Chores fiel, stürzte es ein. Das zeigt uns, wie labil gotische Gewölbe sind. Um die Träume von schwerelos erscheinenden gotischen Kirchen zu verwirklichen, musste man bis an die Grenze des damals Machbaren gehen.
Für die Kunst des Wölbens konnten die mittelalterlichen Baumeister auf die Vorbilder der römischen Bauten zurückgreifen. Diese verwendeten meistens Kuppeln und Tonnengewölbe, letztere vor allem beim Bau der großen Amphitheater, deren steil ansteigende Ränge auf den ringförmigen Erschließungsgängen mit Tonnengewölben aufliegen, wie in El Djem in Tunesien gut zu erkennen ist. Für die geometrisch einfache Form des Mantels eines halben Zylinders konnte man aus Holzbohlen eine Schalung zimmern, auf der das Gewölbe aus Bruchsteinen mit viel Mörtel gegossen wurde.
Die frühmittelalterlichen Kirchenräume hatten als Raumabschluss hölzerne Flachdecken, nur kleinere Raumteile wie Krypten wurden schon vor dem 11. Jahrhundert gewölbt. Vom 11. Jahrhundert an stattete man bereits Seitenschiffe, Querschiffe und Chorumgänge mit steinernen Gewölben aus, wie zum Beispiel den Umgang in der Abteikirche von St. Benoît-sur-Loire von 1067-1108. Tonnengewölbe aber haben ein relativ großes Eigengewicht und entwickeln auf ihre ganze Breite einen seitlichen Schub, brauchen deshalb auch als Widerlager sehr dicke Wände.
Deshalb setzte man das Kreuzgratgewölbe ein, das aus der Durchdringung zweier sich kreuzender Tonnengewölbe entwickelt worden war. Auch bei ihm gibt es nur einfach gekrümmte Flächen aus dem Mantel eines halben Zylinders, so dass die Kreuzgratgewölbe der Nikolaikapelle in Soest aus dem Ende des 12. Jahrhunderts auf einer Schalung gemauert werden konnten.
Das funktionierte nicht mehr, als man in der Hochgotik die Kappen der Kreuzrippengewölbe buste, das heißt zu kleinen, eigenständigen kuppelartigen Formen aus dreidimensional sphärisch gekrümmten Flächen ausbildete. Von oben aus dem Dachraum ist diese Teilung des gebusten Kreuzrippengewölbes in vier Teile durch die einschneidenden Rippen gut auszumachen. Diese Kappen mussten nun freihändig ohne Schalung so gemauert werden, dass kein Stein herunterfiel, bevor alle Teile des Gewölbes sich kraftschlüssig gegeneinander abstützten.
Zunächst wurde und wird auch heute noch unterhalb des Gewölbeansatzes eine Arbeitsbühne geschaffen. Danach stellt man für die Einbringung der Rippen Lehrgerüste auf, die sich diagonal von den gegenüberliegenden Auflagern der Gewölbe in den Raumecken aus spannen und in der Mitte kreuzen. Auf diese hölzernen, in manchen Gegenden Romanten genannten Lehrgerüste vermauert man jetzt die Rippensteine, und zwar gleichzeitig von allen vier Ecken aus, weil sonst die Romanten ungleichmäßig belastet und sich dadurch verziehen würden. Dasselbe ist dann auch beim Einwölben der vier Kappen zu beachten, denn auch dies muss gleichzeitig von allen Rippenansätzen aus erfolgen. Dabei werden die Backsteine fischgrätenartig so miteinander verzahnt, dass sie nicht herunterfallen können. Die Teile stützen sich solange gegenseitig ab, bis der vertikale Druck des zuletzt eingesetzten Schlusssteins dem Ganzen Halt verleiht. Bevor der Mörtel voll ausgehärtet ist, werden die Keile entfernt, mit denen man die Romanten etwas über die angestrebte Höhe hinaus angehoben hatte. Das gesamte Gewölbe sackt darauf hin nach und erreicht dabei seine endgültige Form.
Allein an dieser Stelle wird heute moderne Technik eingesetzt, weil man statt der Holzkeile Öldruckpressen benutzt, die man langsamer und gleichmäßiger absenken kann. Das Erscheinungsbild der neuen Gewölbe ist exakt das Gleiche wie bei den alten. Auch ohne die Hilfsmittel gegenwärtiger Technik haben die Baumeister und Handwerker der Gotik mit ihrem primitiven, aus der einfachen Mechanik entwickelten Gerät die kühn bis zur Höhe moderner Hochhäuser aufragenden Kathedralen geschaffen.
Professor Dr. Dr. Ing-E. h. Gottfried Kiesow
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Mittelalterliche Wandmalereien in Behrenhoff 16.01.2018 Die Hölle Vorpommerns Die Hölle Vorpommerns

In der Dorfkirche von Behrenhoff haben sich eindrucksvolle Darstellungen des Fegefeuers erhalten.
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther 04.07.2017 Ulrich Müther Hyparschalen

Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz