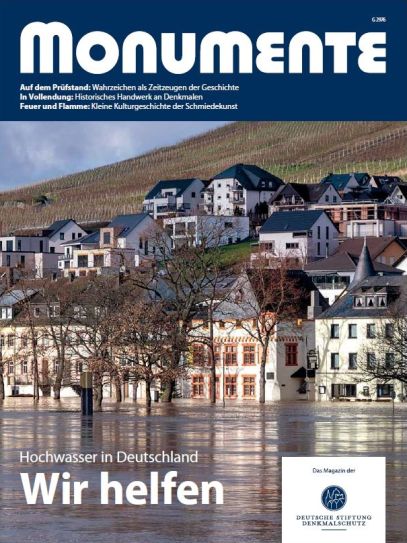Denkmalarten Kleine und große Kirchen Archäologie Stile und Epochen Nach 1945 1925 1900 1200 1000 Ausgabe Nummer August Jahr 2021 Denkmale A-Z J
1.700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland
Eine Frage der Baukultur
Die wechselvolle Geschichte des Jüdischen Lebens ist ablesbar an ihren Bauten in der Stadt und auf den Dörfern, die bis heute überdauert haben. Eine Spurensuche.
Die zwei Männer blicken uns sorgenvoll an, so scheint es. Sie geben den Blick frei auf eine Innenansicht mit Säulen, Würfelkapitellen und Rundbögen. Beim flüchtigen Blick könnte man eine romanische Kirche vermuten. Denn die hebräischen Schriftzeichen auf dem Triumphbogen sieht man vielleicht erst beim zweiten Hinsehen. Das Gemälde zeigt die 1906 eingeweihte neoromanische Synagoge von Osnabrück, Felix Nussbaum malte sie zwanzig Jahre später.

Viele Feiern in diesem Jahr widmen sich der Tatsache, dass seit 1.700 Jahren Menschen jüdischen Glaubens auf dem Gebiet des heutigen Deutschland leben – und bemerkenswerte Bauten geschaffen haben: Ob die Ballinstadt in Hamburg, der jüdische Friedhof in Berlin Weißensee, Krankenhäuser, Synagogen und Keller-Mikwen (Tauchbäder) – jüdische Architekten waren überall maßgeblich beteiligt. 2021 laden viele Synagogen zu Besuchen, Führungen und Veranstaltungen ein. Es ist ein Festjahr, denn im Jahr 321 gestattete Kaiser Konstantin, der sich für das Christentum als Staatsreligion im Römischen Reich entschieden hatte, den jüdischen Bewohnern Kölns immerhin die Ausübung städtischer Ämter.
Frühe Gemeinden
Das Bild der Synagoge im Vorkriegs-Osnabrück gewährt uns einen Einblick in jüdische Baukunst jener Zeit. Ob in Osnabrück, Hannover, Dresden und Köln, Frankfurt, Hamburg, München und Berlin: In diesen und anderen Städten wurden Synagogen im Stil der romanischen Kaiserdome von Mainz, Worms und Speyer errichtet. Dieser neue, neoromanische Stil verband in besonderer Weise den erwachenden Patriotismus der damals in Deutschland lebenden Juden mit der örtlichen Architektur und ist Ausdruck der Vielfalt, mit der in den jüdischen Gemeinden gebaut wurde. In anderen Städten wie Dortmund, Leipzig oder abermals in den großen Gemeinden von Berlin und Köln entstanden Synagogen, mit denen Juden sich zum Ursprung ihrer Religion aus dem Orient bekannten. So entstanden dort Synagogen im neoislamischen Stil.
Überall prägten Synagogen im 19. und 20. Jahrhundert das Stadtbild mit: Historisierend oder auch zeitgenössisch, wie mit der Jugendstilsynagoge von Görlitz, einem langjährigen Förderprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). Aber: „Jüdische Architektur gibt es nicht als essenzielle Kategorie, also aus sich selbst heraus jüdische Baukunst“, wie Dr. Ulrich Knufinke (50), wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bet Tfila-Forschungsstelle für jüdische Architektur an der Technischen Universität Braunschweig sagt. „Es gibt aber immer wieder jüdische Architekturen, also Bauformen mit einer bestimmten Zugehörigkeit oder die in einer bestimmten Tradition stehen.“

Die Synagogen aus dieser Zeit sind Zeugnisse eines wiedererstarkten Judentums: Mit dem Emanzipationsedikt von 1812 wurden Juden zu „Einländern“ und preußischen Staatsbürgern erklärt und jüdische Gemeinden blühten auf, es wurde tatsächlich wieder gebaut. Ihre neue Bewegungsfreiheit ermöglichte ihnen erstmals wieder ein Leben in den Städten, aus denen sie mehr als 300 Jahre zuvor vertrieben worden waren.
Durch diese Ausweisung war eine rund tausendjährige Koexistenz von Christen und Juden in den Städten zu Ende gegangen. Obwohl sie immer eine Minderheit bildeten, konnten sie sich auch nach den Völkerwanderungen zunächst in den größeren Siedlungen wie den Bischofsstädten niederlassen. Dort lebten Juden vermutlich eher in losen Verbänden als in tatsächlichen Gemeinden. Erst für das 10. Jahrhundert in Mainz, dann in Trier, Worms, Speyer und Köln sind jüdische Gemeinden nachweisbar. Für die Entwicklung des Wirtschaftslebens waren sie von enormer Wichtigkeit. Das 1179 aufgestellte Verbot für Christen, Geld gegen Zinsen zu verleihen, sollte sich als Chance für jüdische Händler erweisen.
In diesem Klima bildete sich eine sichtbare jüdische Mittelschicht, die
Häuser in den Stadtzentren erwarb und die Infrastruktur deutlich prägte.
Bis 1350 wuchs die Zahl ihrer Gemeinden wie nie zuvor: Neben Synagogen
mit Ritualbädern, den „Mikwen“, entstanden Brunnen, Schlachtereien und
Bäckereien für die koschere Speisezubereitung.
Der Würzburger Internist Dr. Josef Schuster (67) ist seit 2014 Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland. Mit ihm haben wir über die Bedeutung des Denkmalschutzes für jüdische Bauten gesprochen.
Welche Rolle spielt der Denkmalschutz für jüdische Gebäude?
Unter Denkmalschutz stehende jüdische Bauten wie Synagogen oder Mikwen, also Ritualbäder, stärken definitiv das Bewusstsein für die jüdische Geschichte und Tradition in Deutschland. Es ist wichtig, dieses Erbe, das die Nationalsozialisten vollständig vernichten und aus dem Bewusstsein löschen wollten, zu erhalten. Die Bauten werden heutzutage ja häufig als Museen oder Begegnungsstätten genutzt und können dann sehr viel zu einer Bewusstseinsbildung beitragen. Auch für die jüdische Gemeinschaft selbst sind diese Stätten wichtig für die eigene Identität.
Werden die restaurierten Bauten für Nachfahren in aller Welt wieder sichtbare und besuchenswerte Orte ihrer Familiengeschichte?
Das kann ich aus eigenem Erleben eindeutig bejahen. In meiner Heimat Unterfranken gibt es viele frühere Landsynagogen. Bei Festen anlässlich ihrer Restaurierung werden häufig die Nachkommen früherer jüdischer Bürger des Ortes eingeladen. Manche finden auch von selbst den Weg in die Herkunftsregion ihrer Familien. Durch die restaurierten Gebäude oder Grabsteine finden sie dann einen Anknüpfungspunkt an ihre Wurzeln. Das halte ich für wichtig.
Entsteht durch die Restaurierung jüdischer Gemeindebauten wieder jüdisches Leben auch abseits der großen Städte?

Das ist eher weniger der Fall. Die Entscheidung, wo man hinzieht, hängt – was das Jüdische angeht – sicherlich stärker davon ab, wo man eine moderne jüdische Infrastruktur vorfindet, etwa einen jüdischen Kindergarten und natürlich eine Gemeinde.
Hat das Engagement der teilweise sehr aktiven Fördervereine auch spürbare Auswirkungen für den Zentralrat?
Für den Zentralrat der Juden als politischem Dachverband der Jüdischen Gemeinden spielen die Fördervereine eine untergeordnete Rolle. Aber vor Ort sind sie immens wichtig. Wenn alte Synagogen wieder instandgesetzt oder zu Begegnungsstätten gemacht werden, geht das ganz häufig auf die Initiative von Bürgern und Fördervereinen zurück. Dieses Engagement begrüßen wir ausdrücklich.
Die verschwundenen Synagogen
Die ältesten Beispiele für Synagogen im Mittelalter, die romanischen Synagogen in Köln und Worms, sind gründlich untersucht und sogar digital aufbereitet. Von Regensburg gibt es eine detailreiche Radierung von Albrecht Altdorfer aus dem Jahre 1519. Meist handelte es sich wohl um einen längsrechteckigen, zweischiffigen Saal, gewölbt oder flachgedeckt. Die späteren gotischen Bauten waren oft kreuzrippengewölbt. Sie waren nach Jerusalem ausgerichtet, der Schrein zur Aufbewahrung der Thorarollen, der „Aron haKodesch“, war an der Ostwand untergebracht. Das Lesepult, die „Bima“, befand sich in der Raummitte. Formen und Ornamentik der Portale und Fensteröffnungen entsprachen denen der zeitgleich entstandenen Kirchen. Die Kapitelle der Alten Synagoge in Worms beispielsweise sind mutmaßlich Werke der dortigen Dombauschule. Mikwen waren im Hochmittelalter häufig, die von Andernach, Köln, Speyer, Worms und Erfurt sind noch erhalten.
Diesen Aufschwung beendeten in den Städten die Pestpogrome (Judenverfolgungen) im 14. Jahrhundert. Das meiste wissen wir somit nur aus Quellen und Zeugnissen, denn die wohl rund 400 Sakralbauten dieser Zeit wurden teilweise in christliche Kirchen umgewandelt, viel häufiger jedoch zerstört und abgerissen, entweiht und umgenutzt.
Hinterhofexistenz auf dem Land
Anfang des 16.
Jahrhunderts war jüdisches Leben in den meisten deutschen Städten
erloschen. Viele Juden wanderten aus, beispielsweise ins benachbarte
Königreich Polen. Die in Deutschland Verbliebenen suchten Zuflucht auf
dem Land, wo sie in einigen Dörfern bald die Hälfte der Bevölkerung
ausmachten. Aber ihr Gemeindeleben fand buchstäblich in den Hinterhöfen
statt. Meist wurde nur ein Betraum in bestehenden Gebäuden wie
Wohnhäusern, Ställen oder Werkstätten eingerichtet. So lebten kurz vor
dem Dreißigjährigen Krieg in Deutschland vermutlich nur noch etwa 10.000
Juden. Viele wurden zu Abgaben gezwungen. Anderen jedoch gelang durch
Handel und Geldgeschäfte der wirtschaftliche Aufstieg.

Dass diese ländlichen Gemeinden trotzdem weiterhin gut funktionierten, wird wohl mit dem jüdischen Gebot der Mildtätigkeit zu tun gehabt haben. Juden kümmerten sich, auch gemeindeübergreifend, umeinander. So konnte sich im thüringischen Schmalkalden wieder eine Gemeinde bilden, die 1622 eine Synagoge errichtete. Unweit der Synagoge fand man bei Erdarbeiten kürzlich eine Keller-Mikwe, wie sie überwiegend Frauen für die rituelle Reinigung nutzten. „Das frühneuzeitliche Tauchbad mit mehreren Becken ist außergewöhnlich gut erhalten, auch die qualitätvolle Verarbeitung der Sandsteine ist beeindruckend“, sagt Guido Siebert (54) von der DSD. Im fränkischen Schnaittach sind mit Synagoge, Mikwe und Rabbinerhaus wichtige Zeugnisse jener Zeit erhalten. Hier ermöglicht heute ein Museum Einblicke in die jüdische Landkultur Süddeutschlands.
Das Zeitalter der Vernunft
Nach dem Dreißigjährigen Krieg wuchs die jüdische Bevölkerung wieder. Das mag mit Zuwanderung aus Spanien und Portugal als Spätfolge der Inquisition mit ihren Zwangstaufen zu tun haben. Viele dieser Zuzügler durften sich in den Städten ansiedeln und trugen mit ihren oft internationalen Verbindungen zu deren Prosperität bei. Deutsche Territorialfürsten fühlten sich wohl deshalb veranlasst, das Leben der Juden durch sogenannte Judenordnungen zu regeln und zu schützen. In einigen wenigen Städten wie Krakau, Hamburg und Frankfurt bildete sich ein Mittelstand, dem auch die Errichtung neuer Synagogen gestattet wurde. Die Berliner „Residenzsynagoge“ ist Zeichen dieses Aufschwungs. Sie war ausdrücklich vom König gewünscht, um Hinterhof-Betsäle aufzulösen.
Wirklich tolerant wurde die christliche Mehrheit gegenüber der jüdischen Minderheit jedoch immer noch nicht. 1737 verfügte König Friedrich Wilhelm I., dass alle Berliner Juden, die kein Haus besaßen, in das „Scheunenviertel“ ziehen mussten. An dieser Haltung änderte auch die Aufklärung mit Gotthold Ephraim Lessing und Moses Mendelssohn nur wenig. Die Idee einer „Vernunftreligion“ führte immerhin 1781 zum Toleranzedikt – sozusagen ein Vorgänger des eingangs erwähnten Emanzipationsedikts, und zu einer Verbesserung der Lage im 18. Jahrhundert. Neben den Städten entstanden auch in den Dörfern eigenständige Synagogenneubauten. Sie wurden überwiegend in Fachwerkbauweise als Saalbauten errichtet.

Im westfälischen Telgte beispielsweise wurde Anfang des 18. Jahrhunderts ein kleiner Fachwerkbau von 1500 erweitert und zum jüdischen Betraum umgebaut, seine Instandsetzung förderte die DSD. Frauen mussten mittlerweile nicht mehr in einem abgetrennten Nebengebäude dem Gottesdienst folgen. Sie konnten nun unmittelbarer teilhaben, weil für sie Emporen eingezogen wurden. Womöglich schon 1740 wurde die Synagoge im mecklenburgischen Stavenhagen zusammen mit einem Gemeindehaus errichtet. Sie ist eine der wenigen erhaltenen jüdischen Einrichtungen Mecklenburgs und wurde mit DSD-Unterstützung saniert. Die Jüdische Gemeinde in Kirrweiler bei Speyer kaufte 1766 ein Grundstück, um sogar eine zweite Synagoge mit einer Mikwe zu erbauen. Zwischenzeitlich völlig verwahrlost, wird sie mit Hilfe der DSD wiederhergestellt. In Wörlitz konnte 1789 im Zuge des Zeitenwandels eine Synagoge als Rundbau in prominenter Lage im fürstlichen Park entstehen. Uneigennützig war dies nicht, denn der Fürst brauchte den jüdischen Teil der Bevölkerung zur Belebung der Wirtschaft und deren Eid zur Sicherung seiner Macht.
Ganz auf der anderen Seite, im französisch besetzten Köln, gründete sich eine jüdische Gemeinde, die in einem säkularisierten Kloster ihr Bethaus einrichtete. Mehrere Synagogen-Neubauten, einer davon unter maßgeblicher Mitwirkung des Dombaumeisters, und eine Schule für die rasch wachsende Gemeinde folgten. In Hamburg entwickelte sich mit dem „Grindelviertel“ ein Zentrum der jüdischen Gemeinde mit mehreren Synagogen, einer Schule, einem Waisenhaus und einem Friedhof. Auch in den Kleinstädten wurde rege gebaut, so wie im hessischen Romrod, dessen Synagoge mit Schule und Mikwe 1843 eingeweiht wurde. „Ihr Zustand außen und innen ist fast unverändert, weshalb dem Bau unter den Landsynagogen Hessens eine besondere architektonische und religionsgeschichtliche Bedeutung zukommt“, sagt Dr. Karin Gehrmann (63), DSD. Seit der Instandsetzung wird hier die Geschichte des örtlichen Judentums dokumentiert.

Aufstieg und Ambivalenz
Es folgte ein gutes Jahrhundert mit Freiheiten und Aufstiegschancen. So entstand ein starkes Bürger- und Bildungsbürgertum, aus dem viele Intellektuelle hervorgingen und das prägend war für seine Zeit. Ohne jüdische Wissenschaftler, Künstler und Literaten wäre die neuzeitliche deutsche Kultur nicht denkbar. Und Juden blieben nicht länger nur Bauherren von Gemeindebauten, im Gegenteil, sie gestalteten die Innenstädte und das Alltagsleben ihrer Bewohner maßgeblich: Man denke an die großen Kaufhäuser, mondäne Warentempel in städtischen Spitzenlagen, nicht selten von Star-Architekten geplant, technisch auf dem mondernsten Stand und prägend für die Zeit.
Bei aller Gleichstellung – auch politisch – gab es doch auch immer wieder antijüdische Strömungen. Dennoch, das Vertrauen der Juden in den Rechtsstaat war groß. Ein fataler Irrglaube, wie sich nicht erst nach 1933 herausstellte. Nach Nordund Südamerika, Großbritannien und Palästina emigrierten bereits nach dem Ersten Weltkrieg viele Juden, so dass 1933 nur noch eine halbe Million in Deutschland lebte, überwiegend in den Großstädten. Und sie mussten etwas erleben, dessen Bezeichnung sich auf die altbekannten Gräuel bezog: Bei den Pogromen im November 1938 wurden eintausend Synagogen und jüdische Einrichtungen in Brand gesetzt. Den ländlichen Gemeindegebäuden kam ihre Unauffälligkeit zugute, sie entzogen sich oft der Kenntnis der brandschatzenden Nazis.
Noch ein Neuanfang
In Köln erließ Kaiser Konstantins 321 sein Edikt – und hier gelang 1945 abermals ein entscheidender Schritt. Am 11. April gründeten einige wenige Überlebende in der befreiten Stadt eine kleine jüdische Gemeinde, die erste nach dem Krieg. Seit den 1950er-Jahren konnten zahlreiche Synagogen-Neubauten in Deutschland eingeweiht werden. Von den etwa 2.800 Synagogen aus der Zeit vor 1933 sind nur wenige geblieben, die meisten wurden nach ihrer Zerstörung abgerissen oder umfunktioniert, einige waren nicht mehr als solche zu erkennen. Heute werden jüdische Gemeindehäuser sorgfältig restauriert, Gedenktafeln und Ausstellungen zur Erinnerung eingerichtet.

Sie sind zwar der deutlichste Verweis auf jüdische Bautätigkeit, aber nicht der einzige: Von den Friedhöfen sind die mittelalterlichen von Prag, Worms, Mainz, Köln und Ulm noch erhalten. Meist jedoch wurden sie mit der Vertreibung der Juden aus den Städten eingeebnet, ihre Steine anderweitig verbaut. Später entstanden wieder Begräbnisstätten, ihre Gebäude trugen dem rituellen Umgang mit dem Tod Rechnung: In Waschhäusern etwa wurden die Leichname für die Beisetzung vorbereitet. Diese Gebäude entwickelten sich im späten 18. Jahrhundert zu repräsentativen Trauerhallen weiter. Seit den 1950er-Jahren sind Friedhöfe offiziell geschützt. Sie, ebenso wie alle anderen Zeugnisse jüdischen Lebens, zu bewahren und instand zu halten, ist eine denkmalpflegerische, archivalische und – vor allem – eine mitfühlende Verantwortung. Die DSD fühlt sich dem verpflichtet und hat bislang die Rettung und Instandsetzung von mehr als 30 jüdischen Bauten gefördert. Annette Liebeskind (55), Leiterin der Abteilung Denkmalförderung, sagt dazu: „Durch unsere Hilfe tragen wir dazu bei, dass Orte jüdischen Lebens in Deutschland nicht nur Orte der Erinnerung sind. Vielmehr unterstützen wir aktive Gemeinden dabei, dass in diesen Denkmalen wieder Religion und Kultur gepflegt wird und kultureller Austausch stattfinden kann.“
Julia Greipl
Jüdisches Museum Franken – Schnaittach
Der zukünftige Ausstellungsraum der Kellermikwe Schmalkalden
Der jüdische Friedhof Berlin-Weißensee auf denkmalschutz.de
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Interview mit André Lossin 08.11.2012 Jüdisches Leben in Berlin Jüdisches Leben in Berlin

André Lossin ist Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und gibt Auskunft über die kulturellen Zeugnisse des jüdischen Lebens in Berlin.
-
Wieder sichtbar: Jüdische Geschichte in der ehemaligen Synagoge in Schupbach 17.01.2019 Denkmal mit weltweiten Verbindungen Denkmal mit weltweiten Verbindungen

Für die einfühlsame Sanierung der ehemaligen Synagoge wurde der Förderverein Synagoge Schupbach mit dem Hessischen Denkmalschutzpreis 2018 ausgezeichnet. Eingriffe wurden nur dort vorgenommen, wo sie unbedingt nötig waren. Ziel war es, die besondere Atmosphäre des Betraumes wiederherzustellen.
-
In der Synagoge finden immer noch Gottesdienste statt 08.11.2012 Jüdisches Leben in Bad Nauheim Jüdisches Leben in Bad Nauheim

Am 9. November 1938 demolierten Mitglieder der SA die Inneneinrichtung der Synagoge in Bad Nauheim. Sie legten ein Feuer, das jedoch von mutigen Menschen gelöscht wurde. Daher zählt das jüdische Gotteshaus zu den wenigen, die nach dem Pogrom erhalten blieben. 2012 und 2013 wurde die Synagoge mit Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz saniert.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz