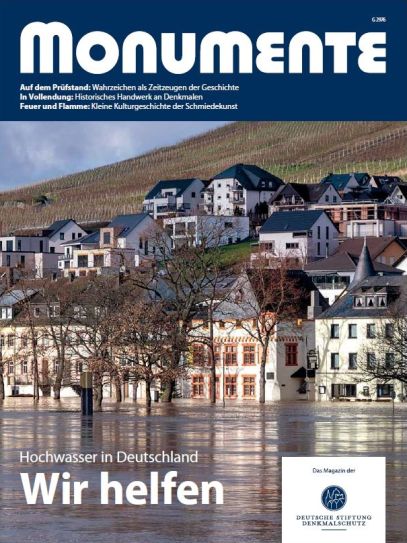Februar 2006
Zur Geschichte des Frisierhandwerks
"Donnerwetter – tadellos!"
"Donnerwetter - tadellos!", bewundert ein Soldat den gezwirbelten Schnurrbart des Flügeladjutanten. An einem Sommernachmittag des Jahres 1901 tritt dieser frisch frisiert und mit Pomade gefettet vor die Tür des Salons François Haby in Berlin. Das militärisch-zackige Lob seines Untergebenen heimst der Adjutant schmunzelnd ein. Der Soldat kann nicht wissen, dass er den Nagel auf den Kopf getroffen hat: Die Pomade, die der Inhaber des Frisiersalons dem Adjutanten soeben höchstpersönlich in den Bart rieb, trägt genau diesen Namen: "Donnerwetter - tadellos".
Den Zeitgeist zu erfassen und daraus Kapital zu schlagen, war die Spezialität des 1880 aus Königsberg nach Berlin zugewanderten Hugenotten François Haby. Haby, den man heute einen Promi- oder Modefriseur nennen würde, machte sich in der Kaiserzeit mit professioneller Eigenwerbung weit über Berlin und Deutschland hinaus bekannt. Als Coiffeur war er stilbildend und als Mensch mit einer gehörigen Portion Mutterwitz ausgestattet. Dieses berlinernde Original, von dem man sich rasieren ließ, um den neuesten Klatsch zu erfahren, sprühte vor Ideen. Furore machte er mit seiner Rasiercreme "Wach auf", - dem "Gipfel der Reinlichkeit" - und seinem Damenshampoo "Ich kann so nett sein". Indem er den "Kaiser-Wilhelm-Aufsteiger" international als letzten Schrei der Bartmode verbreitete, schrieb sich Haby in die Geschichte ein. Den Halt des hochgezwirbelten Bartes gewährleistete seine eigens dafür hergestellte Schnurrbartwichse und die dazugehörige Bartbinde "Es ist erreicht".
Auf den "Fabrikanten feinster Parfümerien und kosmetischer Präparate", wie sich Haby anpries, wurde um 1890 auch Wilhelm II. aufmerksam. Er wollte seinerseits Nutzen aus dem geschäftstüchtigen Mann ziehen, durch dessen Werbung des Kaisers Bart zum Markenzeichen einer ganzen Nation geworden war: "Herr Haby, der Hoffriseur, mußte jeden Morgen 7 Uhr im Schloß erscheinen, er hatte den Hohen Herrn auf allen seinen Staatsbesuchen zu begleiten, um dem Bart die künstlerische Form zu verleihen", heißt es in einem zeitgenössischen Bericht.
Haby verdankt die Stadt Berlin manche amüsante Geschichte. Vieles wäre vielleicht verloren gegangen, wenn Heinrich Mann dem kaiserlichen Zwirbelbart in seinem "Untertan" kein literarisches Denkmal gesetzt hätte. An den umtriebigen Friseur und seine Kreationen aber erinnert noch etwas anderes: Zwei Frisierplätze seines ehemaligen Salons in der Mittelstraße sind erhalten. Dieses künstlerisch hochwertige Interieur, das Henry van de Velde 1901 entwarf, steht sehr viel weniger im Rampenlicht, als es verdient. Nur ganz wenige wissen, dass in den edlen Mahagoni-Sesseln die Berliner Prominenz miteinander schwatzte und sich nach Art des Kaisers frisieren ließ.
Indem Haby einen bereits anerkannten Jugendstilkünstler beauftragte, seinen Laden auszustatten, bewies er abermals Geschäftsinstinkt. Dem Friseur trug das sogar die Beachtung der Kunstkritiker ein, so dass man über Haby bald nicht nur in den Gesellschaftsgazetten Berlins, sondern auch in renommierten Fachzeitschriften wie "Die Kunst" lesen konnte: "Herr François Haby hat den klugen Einfall gehabt, seinen Friseurladen zu einer ,Sehenswürdigkeit der Residenz' zu machen (...) Für jemanden, der jahrelang schaudernd die furchtbaren Barbierstuben mit ihrer Wartesaalatmosphäre erlebt hat, ist es ein ganz eigenes, behagliches Luxusgefühl, zu sehen, wie hier aus den an sich unästhetischen Bedürfnissen eine ästhetische Stimmung hervorgebracht ist. Man möchte wünschen, dass aus jeder Not - und das Rasieren ist eine Not - so sehr eine künstlerische Tugend gemacht würde."
Zur Einrichtung gehörten insgesamt zwölf Herren- und sieben Damenfrisierplätze. Alle Holzteile waren mit rötlich-dunklem Mahagoni furniert, die Waschbecken aus grünem Marmor, ein gemalter Wandfries in violetten Farbtönen gehalten. Alle technischen Einrichtungen, die Röhren und Schläuche der Wasser- und Gasleitungen blieben unverkleidet und zeichnen in ihrer Linienfüh-rung die Umrisse des Mobiliars nach. Ornamental wirken auch die Kleiderhaken neben dem Spiegel, die Griffe der Schubladen, und sogar die Färbeschalen und Brennscheren sind in den einheitlichen Schwung des Interieurs einbezogen. Was uns heute als ein geschmeidig-elegantes Fließen der Leitungen vorkommt, bewertete ein Kunde des Salons, Max Liebermann, in seiner eigenen Art. Ihm gefiel das nackte Metall nicht. Schließlich trüge auch niemand seine Gedärme als Uhrkette, gab er abschätzig zu bedenken.
Die Ausstattung erwies sich als praktisch und solide. Bis in die 1940er Jahre hinein tat sie ihren Dienst. Im Krieg wurde leider die Hälfte zerstört, aber man arbeitete mit dem verbliebenen Rest, bis der Gebäudeteil, in dem der Hoffrisiersalon untergebracht war, 1964 abgerissen wurde. Heute kann sich die Stadt Berlin glücklich schätzen, dass der Privatsammler Jörg Maiwald zu DDR-Zeiten wenigstens zwei Frisierplätze, die zu den Henry-van-de-Velde-Klassikern gehören, über die Zeit rettete.
Dieses Interieur ist ein Denkmal, um das sich ungewöhnlich viele Geschichten ranken. Norma-lerweise fallen Frisierläden schnell der Erneuerungslust oder dem Renovierungsdruck zum Opfer, weil sich Geschäftsleute nun einmal am Markt orientieren.
Über das Frisierhandwerk und die wechselnden Frisurenmoden gibt es viel zu lesen, aber wenig darüber, wo Barbiere, Perückenmacher und Friseure ihrer Kunst nachgingen. Aufgrund von Grä-berfunden wissen wir, dass die Ägypter schon 4000 v. Chr. ihre Haare mit Messern, Haarnadeln und Kämmen pflegten und ab zirka 3000 Perücken trugen und ihre Haare färbten. Damals führten die Friseure keine eigenen Geschäfte, sondern sie suchten sich ihre Kunden auf der Straße oder machten Hausbesuche. Wer es sich leisten konnte, ließ sie als Dienstpersonal im Haus wohnen. Bei Grabungen im Tempel der Königin Hatschepsut fand man Reste eines Hoffriseur-Salons mit Arbeitsmitteln wie künstlichen Bärten, die damals übrigens auch Frauen trugen. Der Friseur als Hofbeamter gehörte zu den angesehenen Berufsständen.
In Jost Ammans Ständebuch von 1568 ist eine der seltenen Abbildungen einer Barbierstube der frühen Neuzeit zu finden. In dem großen Fenster flattert eine Aderlassbinde. Die Einrichtung ist äußerst luxuriös, aber übersichtlich. Ein vornehm gekleideter Barbier schneidet einem Kunden im eleganten Armlehnsessel die Haare. Im Hintergrund kniet ein zweiter Mann auf einem "Zwagh-Stuhl". Der Treppensitz erleichtert auf genial einfache Weise das Haarewaschen. An einer Stange über dem Becken hängt ein gelochter Topf als Spender für Lauge.
Hans Sachs versah diesen Holzschnitt mit Versen: "Ich bin beruffen allenthalbn/Kann machen viel heilsamer Salbn/Frisch wunden zu heiln mit Gnaden /Dergleich Beinbruech und und alte Schaden/Franzosen heyln/den Staren stechn/Den Brandt leschen und Zeen außbrechn/Dergleich Balbiern/Zwagen und Schern/Auch Aderlassen thu ich gern." Und damit übertrieb Sachs nicht.
Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert lag die komplette Körperpflege und wundärztliche Versorgung in den Händen von Badern und Barbieren. Seit dem 14. Jahrhundert bildeten die Bader - so genannt, weil sie meist eine öffentliche Badestube betrieben - eine Zunft. Ihre Ausbildung dauerte zwei bis vier Jahre. Bis 1843, bevor seine Befugnisse in Deutschland beschnitten wurden, war der Bader gleichzeitig Friseur, Arzt und Masseur, er zog Zähne, schröpfte, setzte Klistiere und behandelte Verletzungen, Stich-, Hieb- und Schusswunden, Brüche, Verrenkungen, Hautlei-den und Geschwüre. Der Bader amputierte, und er obduzierte. Im 19. Jahrhundert trennten sich die Wege: Aus dem Bader erwuchs der Heilgehilfe, aus dem Barbier der Herrenfriseur mit eigener Innung. Salons waren noch nicht verbreitet, denn viele gingen ins Haus ihrer Kunden.
Das Friseur- und Perückenmacherhandwerk begann wie so vieles andere mit dem französischen Sonnenkönig zu blühen. Ludwig XIV. machte die arbeitsintensive Allongeperücke erst hof- und dann gesellschaftsfähig. Im Spätbarock war der Friseur ein angesehener Mann, der den Degen tragen durfte und oft zu den engsten Vertrauten der Herrschenden zählte. In seiner Werkstatt - auf Kupferstichen gibt es schöne Abbildungen dieser Interieurs - fertigte der Perückenmacher aus echten Haaren den Kopfschmuck an. In Paris steigerte man den Pomp derart, dass die Damen und Herren mit ihren abenteuerlichen Hochfrisuren kaum noch eine Kutsche besteigen konnten.
Mit dem Sturm der Französischen Revolution wurden diese Kunstwerke - um Draht geflochtene Türme, Grotten, Gemüsegärten und Springbrunnen - jäh und unwiederbringlich hinweggefegt. In der Zeit des Umbruchs trugen die Männer Zottelhaar, und ihre Bärte wuchsen wild. Die Glanzzeit der französischen Coiffeure war erst einmal vorüber, ehe dann im 20. Jahrhundert nach den Moden wechselnde Frisiersalons mit ihren Dauerwellen und Systemform-Haarschnitten für jeder-mann die Republik eroberten. Salons im kunstvollen Design werden wohl auch weiterhin zum Bild unserer Prachtstraßen gehören, denn das Thema Schönheit ist unsterblich.
Dr. Christiane Schillig
Van de Veldes Frisiersalon ist zur Zeit leider nicht zu sehen und befindet sich im Depot der Stiftung Stadtmuseum Berlin. Ehemals wurde ein Teil des Jugendstilinterieurs im Friseurmuseum Alt-Marzahn an Berlins Stadtrand gezeigt, das aber geschlossen werden musste.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Otto Bartning und seine Kirchen 09.03.2016 Bartning Kirchen Spiritualität in Serie

Otto Bartning gehört zu den bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Wegweisend sind seine Raumschöpfungen im Bereich des protestantischen Kirchenbaus.
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Die neue Lust am Bungalow 08.11.2012 Bungalows Die Leichtigkeit des Steins

Fast 17 Millionen Dollar. Das ist auch für das Auktionshaus Christie's keine alltägliche Summe. Bei 16,8 Millionen Dollar ist im Mai bei einer Auktion in New York für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst der Zuschlag erfolgt, und zwar für - und das ist ebenso ungewöhnlich - ein Bauwerk. Nicht einmal ein besonders großes.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz