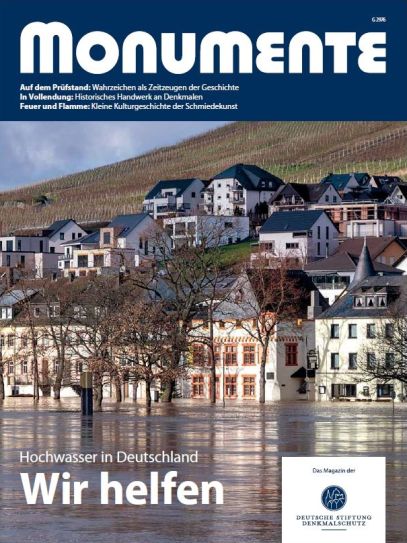Denkmalarten Kleine und große Kirchen Stile und Epochen 1800 Menschen für Monumente Menschen für Denkmale Restaurierungstechniken Ausgabe Nummer April Jahr 2023 Denkmale A-Z S
Wir vor Ort: Schlosskapelle Weimar
Vom Stahl befreit
Es war ein langer Weg, bis die Schlosskapelle in Weimar im 19. Jahrhundert Gestalt angenommen hatte. Ebenso lang war der Weg, bis sie ihr altes, glänzendes Aussehen wiedererlangte. Ein Mammutprojekt, das nur gemeinsam gestemmt werden konnte.
Projektleiterin Birgit Busch hatte eingeladen: Zum ersten Mal konnten im Juni 2021 die Protagonisten, die bei der Wiederherstellung der Schlosskapelle in Weimar maßgeblich beteiligt waren, den Raum in Gänze erleben – die behördlichen Denkmalpfleger, die der Klassik Stiftung Weimar, die Architekten, die Restauratoren, die Handwerker und die Mitarbeiter der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD). Busch, leitende Restauratorin der Abteilung Bau und Denkmalpflege in der Klassik Stiftung Weimar, brachte die Freude über die Vollendung dieses Großprojektes auf den Punkt: „Auf diesen Moment haben wir alle lange gewartet.“

Bücherarchiv statt Schlosskapelle
Das Projekt nahm in diesem Sommer eine entscheidende Etappe. Denn über 50 Jahre war es in der Schlosskapelle in Weimar nicht mehr möglich gewesen, den Blick entlang der purpurfarbenen stuckierten Säulen und über die Rundbögen nach oben bis zur Holzbalkendecke schweifen zu lassen. Seit 1964 beherrschte eine Stahlkonstruktion aus vier Etagen den zuvor profanierten Raum. Die damaligen Verantwortlichen hatten entschieden, die Schlosskapelle als Bücherarchiv zu nutzen. Der Raum war vollkommen zugebaut, in die Wände mit den Malereien das Tragesystem brutal eingestemmt worden.
Geweiht wurde die heutige Kapelle 1847, 1868 wurde sie neu ausgestattet, unter anderem mit der dekorativen Wandfassung. Über den bewegenden Moment, als die Einbauten entfernt wurden, berichtet Projektleiterin Busch: „Mit einer hydraulischen Schere wurden die Stahlplatten in Stücke geschnitten und über die Fenster per Kran herausgebracht. Ich habe jeden Tag Fotos gemacht, so etwas erlebt man nur einmal.“

Seit 2010, nachdem mit dem neuen Tiefmagazin der
Herzogin-Anna-Amalia-Blibliothek die Buchbestände umgelagert werden konnten,
hatte man sich Gedanken zu einer Wiederherstellung der Kapelle gemacht.
Ermöglicht wurde das groß angelegte Rettungsprojekt dann durch Bundesmittel und
die finanzielle Hilfe der DSD. Diese konnte als Treuhänderin einer Großspende
1,75 Millionen Euro der Klassik Stiftung Weimar als Eigentümerin zur Verfügung
stellen und in Absprache mit ihr die Auftraggeberaufgaben bei der Abwicklung
der Bauaufträge übernehmen. Auch an der Erarbeitung des restauratorischen
Konzepts beteiligten sich die Referenten der DSD intensiv und brachten ihre
Erfahrung regelmäßig mit ein, allen voran der damalige DSD-Architekt Rainer
Mertesacker.
Erfahrung, die gerne aufgenommen wurde. Restaurator Stephan Keilwerth, der alle restauratorischen Arbeiten organisierte, weiß über sehr engagierte Diskussionen zu berichten – stets konstruktiv und gemeinsam am Ziel orientiert.

Akribisch geplant
Denn jedes Detail wirft Fragen auf, die es zu beantworten gilt – auch wenn früh feststand, dass als Grundlage der Wiederherstellung die zweite Farbfassung, nämlich die von 1868/69 dienen würde: Sollten zum Beispiel die ausgebesserten Stellen im Stuckmarmor der Säulen sichtbar bleiben, dort, wo einer der stählernen Archivböden angesetzt worden war? Sollten Fehlstellen an den imposanten Buchstaben der Altarwandinschrift nachvergoldet werden oder in Ocker die Wunden der Baugeschichte dokumentieren?
Man entschied sich jeweils für die Ablesbarkeit der Vergangenheit. „Rekonstruktion und Original bilden eine harmonische Einheit, sollen aber beim genauen Betrachten sichtbar bleiben“, erklärt Rainer Mertesacker. Wie auch bei den Farbfassungen in der Apsis. Ausgeführt wurden die Reinigungen und Ausbesserungen der Malereien 2021 unter anderen von zwei Teilnehmerinnen der Jugendbauhütte Thüringen, einem Projekt der DSD. Ein einprägsames Teamerlebnis, wie Ricarda Schecke, damals 19 Jahre alt, erzählen konnte: „Das Arbeitsklima hier ist super.“ Aber auch inhaltlich beeindruckend: „Mir gefällt es, dass man hinter die Kulissen schauen kann und Zugang zu Bereichen hat, die Außenstehende nicht haben. Und wir arbeiten im Schloss Weimar an einem Weltkulturerbe!“

Die Schlosskapelle ist Teil der vierflügeligen Schlossanlage in Weimar und die wiederum Teil des UNESCO-Welterbes Klassisches Weimar. Geplant wurde die Kapelle seit 1806, zunächst in klassizistischen Formen und als an den Westflügel anschließenden pavillonartiger Bau in der Südwestecke des Schlosses. Planungsänderungen gab es ab 1844 durch Maria Pawlowna, die Schwester des russischen Zaren, und ihren Sohn Erbgroßherzog Carl Alexander. Nun entstand eine Kapelle in neoromanischem Stil und im Verbund mit dem Westflügel. Der zweigeschossige Raum mit südlicher Apsis ist von Arkaden gerahmt. Er steht auf einem erdgeschossigen Gewölbe und einer Tordurchfahrt, die von Westen in den Schlossinnenhof führte. Keine einfache architektonische Situation, die auch heutigen Planern viel abverlangt.
Weimarer Schlosskapelle:
Geschichte und Restaurierung

1789 - Baubeginn Schloss Weimar:
Nach einem Brand 1774 wird die Wilhelmsburg in Weimar als klassizistisches Schloss neu errichtet, zunächst ohne eine Kapelle. Im südlichen Westflügel soll ein repräsentatives Treppenhaus entstehen. Erst 1828 wird an dieser Stelle in einem Eckpavillon eine Kapelle geplant.
1847 - Einweihung der Schlosskapelle:
Die nach Wünschen von Erbgroßherzog Carl Alexander byzantinisch gestaltete Kapelle wird am Palmsonntag geweiht. Vermutlich 1868/69 wird der Innenraum neu gestaltet.
1950 - Schlosskapelle als Bachstätte:
In Erinnerung an den weltberühmten Musiker und seine Zeit in Weimar wird die Kapelle zu einem Konzertsaal umgestaltet.

1964 - Einbau Archiv:
Um als Bücherarchiv der Anna-Amalia-Bibliothek dienen zu können, werden in die Kapelle stählerne Regalböden, eine Wendeltreppe und ein Aufzug eingebaut.
2011 - Erste Maßnahmen einer Restaurierung:
Unter dem einfarbigen Anstrich des 20. Jahrhunderts finden die Restauratoren die ursprünglichen Farbfassungen. Das Apsisgemälde von 1868 ist erhalten.
2018 - Finanzierung der Restaurierung:
Ein DSD-Stifter stellt zunächst
1,4 Millionen Euro, am Ende sogar 1,75 Millionen Euro für die Wiederherstellung der Schlosskapelle zur Verfügung.
2020 - Beginn des Projekts:
Restaurator Stephan Keilwerth kennt bald jeden Quadratzentimeter der Kapelle und achtet darauf, dass die Restauratoren aller Fachbereiche Hand in Hand arbeiten.
2021 - Ausbau Stahlböden:
Der Ausbau der mehrgeschossigen Stahlböden ist eine Herausforderung. 70 Tonnen Stahl müssen per Hand mit Sägen und einer hydraulischen Schere vorsichtig entfernt werden.

2022 - Restaurierung Fenster:
Die bleiverglasten und die eichengerahmten Radfenster mit den satinierten Glasscheiben werden aufgearbeitet. Auf der Ostseite sind sie nur noch Blindfenster, weil ab 1913 dahinter der Südflügel des Schlosses errichtet wurde.
2022 - Restaurierung Böden:
Auch hier müssen außergewöhnliche Entscheidungen getroffen werden. Aufgrund der schwierigen baulichen Situation wird der Marmorboden schließlich ex situ restauriert und erst anschließend wieder verlegt.

2022 - Kulturspuren:
Die Schlosskapelle als Tatort – für das DSD-Jahresthema KulturSpur dient die Schlosskapelle als Motiv und wird bundesweit plakatiert.
2023 - Einbau der restaurierten Leuchter:
Als eine der letzten, aber besonders wirkungsvollen Maß- nahmen werden die von Bernhard Mai restaurierten Leuchter installiert.

2023 - Fertigstellung Ostern 2023:
Die Schlosskapelle ist restauriert und wird im Rahmen von Führungen wieder erlebbar sein.
Moderne Erleuchtung
Maria Pawlowna ist auch Urheberin der raumprägenden Hängeleuchter. Sie waren Teil der reichen und wertvollen, durch sie finanzierten Ausstattung. Pawlowna hatte eine ölbetriebene Leuchte in Paris entdeckt und sie als Vorbild mit nach Weimar gebracht. Hängeampeln sind in der russisch-orthodoxen Kirche üblich und erinnerten sie an ihre Heimat. Modernste Technik zeichneten die Leuchten aus. Mit Rundbrennern, zylindrischen Hohldochten und Glaszylindern funktionierten sie über das Prinzip der kommunizierenden Röhren. 15 der Lichtampeln waren über die Jahre im Schlossdepot verwahrt worden und konnten restauriert werden.

Die Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar, Ulrike Lorenz, verantwortlich für rund 30 Museen, Schlösser und Parks und für die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, ist der Schlosskapelle stets nahe, denn ihr Büro liegt im ehemaligen Stadtschloss. Die derzeit laufende Grundsanierung des Stadtschlosses erlebt sie täglich am eigenen Leib. Sie möchte das klassische Erbe Weimars nicht nur im wörtlichen Sinne entstauben, sie möchte es in die Zukunft führen. Ein Projekt, für das man einen langen Atem braucht. Die Fertigstellung der Kapelle ist ein Baustein dafür.
Seit den 1960er Jahren war sie nicht zugänglich. Ab Ostern ändert sich das: Dann kann die Schlosskapelle besichtigt werden, vorerst nur im Rahmen von Führungen. Als eine der letzten Maßnahmen wurden die restaurierten Leuchter installiert, mitsamt der Originalleuchte aus Paris. Warmes Licht gibt dem Raum seinen Frieden zurück – alles ermöglicht durch die Großzügigkeit eines einzelnen Spenders, der sich dieses Bild trotz stählerner Einbauten hatte ausmalen können und der die Durchführung des Großprojekts den Experten der Klassik Stiftung Weimar und der DSD anvertraute.
Beatrice Härig
www.denkmalschutz.de/schlosskapelle-weimar
Informationen zu Besichtigungen und Führungen:
Schlosskapelle Weimar
Burgplatz 4
99423 Weimar
Tel.: 03643 545500
Ab 8. April 2023, samstags 12 Uhr und 14 Uhr
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
St. Christophorus in Weimar-Tiefurt wurde baupolizeilich gesperrt 08.11.2012 Kirche dringend gebraucht! Kirche dringend gebraucht!

Die Kirche ist vom Einsturz bedroht! Wie man gut nachvollziehen kann, löste diese Diagnose im vergangenen Jahr großes Entsetzen bei der Kirchengemeinde im Weimarer Ortsteil Tiefurt aus. Weil ein Holzschutzgutachten vorbereitet werden sollte, hatte Jörg Rietschel, Ortsbürgermeister und Gemeindekirchenratsmitglied, im April 2010 einen Blick in den Dachstuhl geworfen und gravierende Schäden entdeckt. Nach einer Begehung durch Bausachverständige und den Weimarer Oberbürgermeister Stefan Wolf musste die Kirche baupolizeilich gesperrt werden. Offenbar hatte der Orkan Emma, der Anfang März 2008 mit großer Wucht auch über Tiefurt hinweggerast war, dem ohnehin morschen Dachgebälk so zugesetzt, dass Gefahr im Verzug war.
-
DSD-Stiftungsarbeit: Ein- und Ausblicke 24.01.2024 Viel Herz, wichtiger Verstand Viel Herz, wichtiger Verstand

Die DSD hat 2023 nicht nur erfolgreich gefördert, sondern auch hart gekämpft. Sie setzte sich vehement für Denkmale ein und wehrte sich gegen Abrisse. Die große Hilfe der Förderer zeigt, dass nachhaltiger Denkmalschutz politisch und gesellschaftlich relevant ist. Danke, dass Sie uns dabei unterstützen!
-
Das Phänomen Bauhaus 1919–1933 17.01.2019 Kein Raum für Ballast Kein Raum für Ballast

Als Walter Gropius 1919 das Bauhaus gründete, wollte er die Gesellschaft verändern. In den 14 Jahren ihres Bestehens wurde die Schule für Kunst, Handwerk und Architektur zu einer Ideenschmiede, die bis heute weltweilt das Verständnis von Design und Architektur beeinflusst.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz