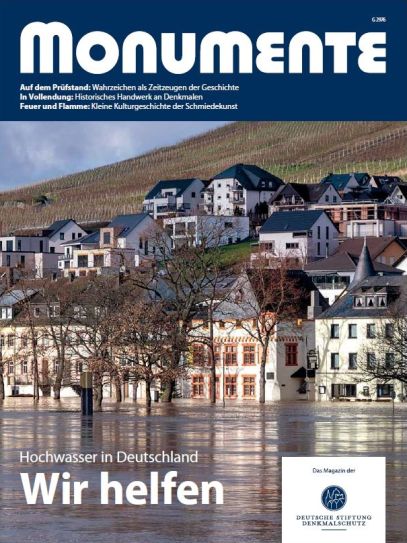Streiflichter Handwerk Ausgabe Nummer Oktober Jahr 2019
Von der hohen Kunst des Glockengießens
Spannend bis zum Schluss
Bronzeglocken – Meisterwerke wie für die Ewigkeit geschaffen. Begleiten Sie die traditionelle Herstellung einer Kirchenglocke in unserer Bildergalerie und in einer Dokumentation des SWR.
Gescher im Landkreis Borken. Seit 2013 trägt die knapp 17.000 Einwohner zählende Stadt, ca. 50 km westlich von Münster gelegen, den offiziellen Namenszusatz Glockenstadt. Hier ist seit über 230 Jahren die Glockengießerei Petit & Gebrüder Edelbrock ansässig. Sie hat sich mit Kunstguss und der regelmäßigen Wartung von vornehmlich historischen Glockengeläuten und Turmuhren weitere wirtschaftliche Standbeine geschaffen.
Denn in Zeiten
aufgegebener Kirchen fordert der gesunkene Bedarf an neuen Glocken seinen
Tribut. Neben der Gießerei in Gescher hat sich noch eine Handvoll
Traditionsgießereien in Deutschland erhalten – immerhin mehr als in anderen europäischen
Ländern.

Wir besuchen die Gießerei an einem heißen Julitag. Hoch aufmerksam stehen die Gießer in ihren silbrig glänzenden Brandschutzmänteln vor dem Ofen, in dem bei etwa 1.100 Grad Celsius die „Götterspeise“ für eine Bronzeglocke geschmolzen wird. Die in der Halle der Glockengießerei herrschende Temperatur ist beachtlich. Wie erst muss es sich anfühlen und anhören, wenn der viel größere, 13-Tonnen fassende Schmelzofen in Betrieb ist und die Bronze lavaartig durch die einzelnen Rinnen in die eingegrabenen, sprich eingedämmten Glockenformen aus Lehm fließt?
Selbst der Tiegelguss einer kleineren Glocke, wie an diesem Tag einer 270 Kilogramm schweren für die Kirche im sachsen-anhaltischen Trebitz, ist spektakulär. Kein Wunder, dass kurz vor Beginn oft ein Geistlicher mit einem Gebet um göttlichen Beistand bittet.
Wie stets spiegelt sich auch heute in den Gesichtern der anwesenden Zuschauer alles wider: Die Freude, dass sich die Kirchengemeinde endlich eine Glocke für ihr Gotteshaus in Auftrag geben konnte; die Aufregung, ob der Guss gelingt; das Bewusstsein, eine historische Handwerkskunst zu erleben und damit an einer jahrhundertealten Tradition teilzuhaben; und nicht zuletzt das Wissen um die Emotionen, die bei ihrem Klang, vor allem bei Kirchenglocken, geweckt werden.
Begleiten Sie die Glockengießer bei ihrer Arbeit in unserer Bildergalerie und in der SWR-Doku "Handwerkskunst! Wie man eine Glocke gießt"!
Petit & Gebr. Edelbrock, Glocken- und Kunstguss-Manufaktur, Hauptstraße 5, 48712 Gescher, Tel. 02542 9333-0, Führungen nach Anmeldung
Westfälisches Glockenmuseum Gescher, Lindenstraße 4, 48712 Gescher, Tel. 02542 7144, geöffnet Di–So 10–17 Uhr und nach Vereinbarung
Deutsches Glockenmuseum e. V., Lindenstraße 2, 48712 Gescher
Kurz dargestellt - Wozu dienen Glocken?
Seit Menschengedenken begleitet Glockengeläut weltweit das alltägliche Leben der Menschen. Es teilt den Arbeitstag ein und weist auf Besonderes hin. Kirchenglocken rufen zum Gebet, künden vom hohen Festtag, begleiten Hochzeit, Taufe und Trauerfeier. Signalglocken, ob an Land oder zu Wasser, warnen, leiten und sind durch ihren dissonanten Klang eindeutig zu erkennen.
Alles, was Aufmerksamkeit benötigte, wurde und wird mit Glocken ausgestattet, selbst das Vieh auf der Weide. Im Brauchtum galt ihr Klang als Unheil abwehrend und vor Krankheit schützend. Auch die ersten Kinderrasseln waren Schellen, um den Säugling zu beschützen.
Im Christentum kamen Glocken ab dem 6. Jahrhundert mit den irischen
Wandermönchen auf. Diese trugen aus leichtem Blech geschmiedete Schellen und
Glocken bei sich, um sich anzukündigen. Dass Kirchenglocken so hoch in Türmen
hängen und ihr Klang mit Schallblenden gelenkt wird, dient nicht nur dazu, dass
die Menschen sie meilenweit hören – ihr Klang soll auch die Gebete in den
Himmel zu Gott tragen.
Heute ist das Handwerk des Metall- und Glockengießers ein Ausbildungsberuf von drei Jahren in ortsansässigen Unternehmen. Früher waren Glockengießer Wandergesellen. Sie stellten die schweren Glocken von März bis Oktober vor Ort her, wobei ihnen die Bewohner bis zum Aufkommen des Zunftwesens helfen mussten. Sogenannte Bienenkorbglocken sind hierzulande die frühesten erhaltenen Gussglocken

und wurden im Wachsausschmelzverfahren hergestellt. Ab dem 12. Jahrhundert etablierten sich Bronzeglocken im Lehmformverfahren. Der Höhepunkt in Guss und Klang wurde in der Spätgotik erreicht – und die über vierhundert Arbeitsschritte sind bis heute tradiertes Vorbild.
Christiane Rossner
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Mittelalterliche Wandmalereien in Behrenhoff 16.01.2018 Die Hölle Vorpommerns Die Hölle Vorpommerns

In der Dorfkirche von Behrenhoff haben sich eindrucksvolle Darstellungen des Fegefeuers erhalten.
-
Die neue Lust am Bungalow 08.11.2012 Bungalows Die Leichtigkeit des Steins

Fast 17 Millionen Dollar. Das ist auch für das Auktionshaus Christie's keine alltägliche Summe. Bei 16,8 Millionen Dollar ist im Mai bei einer Auktion in New York für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst der Zuschlag erfolgt, und zwar für - und das ist ebenso ungewöhnlich - ein Bauwerk. Nicht einmal ein besonders großes.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz