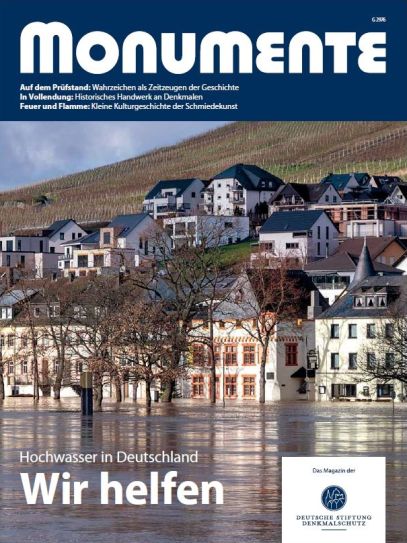Eine Kulturgeschichte der Weihnachtsbräuche
Printenmänner und Posaunen-Engel
Von Baumschmuck und "phrygischer Mütze": Die Weihnachtsbräuche, die wir heute so schätzen, reichen zurück in die Biedermeierzeit - und darüber hinaus.
An die kleine Schlafstatt mit dem Neugeborenen tritt ein schwarz gekleideter Mann mit Laterne, eine Etage darüber trägt ein Kollege mit drei anderen bekrönten Männern Geschenke, und ganz oben spielen weiß gekleidete Frauen mit goldenen Flügeln Posaune: Wir blicken in eine Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge. Das dortige Kunsthandwerk spiegelt viel von dem wider, was Weihnachtsbräuche im deutschen Sprachraum so vielseitig und einzigartig macht: die Verschmelzung von regionalen Traditionen und christlichen Motiven.
Vorbild Biedermeier
Zwar lässt die teilweise mehrere Jahrhunderte alte Handwerkskunst anderes vermuten, tatsächlich aber ist die Weihnacht, so wie wir sie heute vor Augen haben, eine verhältnismäßig neue Erscheinung: die Zimmer festlich dekoriert, die Familie vereint am Esstisch, die Geschenke gehäuft unter dem geschmückten Weihnachtsbaum. Das ist die Weihnachtsfeier, wie sie die Zeit des Biedermeier nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches, nach der Säkularisation und der Zerschlagung kirchlicher Strukturen vor etwa 200 Jahren hervorgebracht hat. Und diese weihnachtliche Biedermeierstube ist verewigt in Kunst und Belletristik:
„In dem Augenblick ging es mit silberhellem Ton: Klingling, klingling, die Türen sprangen auf, und solch ein Glanz strahlte aus dem großen Zimmer hinein, dass die Kinder mit lautem Ausruf ‚Ach! – Ach!‘ wie erstarrt auf der Schwelle stehenblieben. (…) Der große Tannenbaum in der Mitte trug viele goldne und silberne Äpfel, und wie Knospen und Blüten keimten Zuckermandeln und bunte Bonbons und was es sonst noch für schönes Naschwerk gibt, aus allen Ästen. (…) Um den Baum umher glänzte alles sehr bunt und herrlich – was es da alles für schöne Sachen gab – ja, wer das zu beschreiben vermöchte!“ So schildert E. T. A. Hoffmann 1816 in seinem Kindermärchen „Nussknacker und Mausekönig“ den langsam erst entstehenden Brauch, sich zu Weihnachten zu beschenken und diese Geschenke an den Baum zu hängen oder darunter zu legen.
Der paradiesische Baum
Dem Weihnachtsbaum kommt eine zentrale Rolle zu, was auch nicht wundert, schließlich symbolisiert der Baum in unzähligen Kulturen und Religionen das Leben. So war er zunächst Kulisse für Krippenspiele, und zwar als Paradiesbaum. Ab dem späten 16. Jahrhundert emanzipierte er sich vom Krippenspiel und wurde zum eigenständigen Schmuck in der Weihnachtszeit; für 1605 ist der erste geschmückte Weihnachtsbaum in Straßburg, das erst 1681 französisch wurde, bezeugt. Bis zum 18. Jahrhundert fand man dekoriertes Grün eher in protestantischen Familien, eine Krippe eher in katholischen. Lieselotte von der Pfalz, die Schwägerin des französischen Sonnenkönigs Ludwig XIV., versuchte 1708, mit einem enthusiastischen Brief die Franzosen von dem deutschen Brauch zu begeistern.
Aber es dauerte bis 1840, bis in Frankreich der erste verzierte und beleuchtete Christbaum stand. Nach England soll er zur selben Zeit durch die Heirat von Albert von Sachsen-Coburg und Gotha mit Königin Viktoria gelangt sein. Österreich war um 1820 etwas schneller.
Zwar waren diese frühen Beispiele geschmückt, aber, zumindest in den privaten Haushalten, noch unbeleuchtet, denn Bienenwachskerzen waren ein Luxusgut. Das änderte sich erst 1818 mit der Erfindung des Stearins, das Kerzen erschwinglich machte. Hier vereinigen sich, wie so häufig bei den unterschiedlichen Bräuchen zu Weihnachten, profane und liturgische Bedeutungen: Die längsten Nächte des Jahres werden erhellt, und das Licht spendet Hoffnung in der Dunkelheit. Für die Christen ist es Jesus, menschgewordener Sohn Gottes, der das Licht in die Welt bringt.
Exportschlager Christbaumschmuck
Auch die Farbigkeit des Schmucks ist mit Bedeutung aufgeladen: Das Grün des Baumes – oder oft auch nur der gesteckten Äste – steht für das Leben, rot sind die Blüten und Früchte, die die Natur hervorbringt. Viele Christen ahnen im Rot des Schmucks schon das Blut, das Jesus Christus am Kreuz vergießen wird. Dem langsamen Schwinden der Christbaumsymbolik werden zunehmend dekorative Elemente entgegengesetzt: Lametta, das seit dem späten 19. Jahrhundert hergestellt wird, kann noch als Engelshaar gedeutet werden.
Die immer phantasievolleren Kugeln aus Materialien wie Glas, Metall und Kunststoff dienen nunmehr als Ersatz für die ursprünglichen, roten Paradiesäpfel und eröffnen Kunsthandwerkern und Sammlern ganz neue Möglichkeiten. Die Geburtsstunde der heute noch beliebten Glaskugeln schlug 1870, als es Justus von Liebig erstmals gelang, hohle Glaskörper von innen zu versilbern. Die thüringische Stadt Lauscha war zu dem Zeitpunkt schon dabei, sich als Zentrum des gläsernen Christbaumschmucks zu etablieren – Erfahrung war reichlich vorhanden, denn bereits seit dem 12. Jahrhundert wurde im Thüringer Wald, wie seit dem 14. Jahrhundert übrigens auch im Bayerischen Wald, nachweislich Glas hergestellt.

Die verschönerte Wartezeit
Zum vorweihnachtlichen Schmuck der Haushalte gehört seit 180 Jahren auch der Adventskranz: In einem Hamburger Wohnhaus für Kinder aus sozial schwachen Familien sorgte dessen Leiter für Vorfreude auf die Ankunft (lateinisch: „adventus“) des Herrn, indem er vier große weiße und 19 kleine rote Kerzen auf einen Kranz steckte. Protestantische Familien verzichteten zunehmend auf die 19 Werktagskerzen, so dass die vier großen Sonntagskerzen übrigblieben. Vermutlich war es in Köln, wo erstmals 1925 ein Adventskranz in der heute bekannten Art mit den vier Kerzen in einer katholischen Kirche erstrahlte.
Eine andere Möglichkeit, die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen, sind Adventskalender. Gerade in protestantischen Familien wurden mit Kreidestrichen oder kleinen Bildern die Tage markiert. 1908 erschien erstmals der „Münchner Weihnachtskalender“, dessen 24 Felder mit je einem Gedicht aus einem mitgelieferten Ausschneidebogen beklebt werden durften. Von da war der Weg zu dem mit Süßigkeiten befüllten Kalender nicht mehr weit. Ganz anders und noch verhältnismäßig jung sind die „Lebendigen Adventskalender“, oft von engagierten Nachbarn organisiert. Man trifft sich in netter Atmosphäre bei Musik und mit Texten zur Einstimmung auf das Fest. Hierfür schmücken die täglich wechselnden Veranstalter oft ein Fenster, den Eingang, die Garage oder das ganze Haus, und man kann so manchmal einen Blick hinter sonst verschlossene Türen werfen.

Schmuck und Spielzeug aus Holz
Schauen wir noch einmal in die weihnachtliche Biedermeierstube, da fallen neben Kerzenschein, Weihnachtsbaum, Glasschmuck und Spielzeug für Kinder kleine Holzspielsachen am Christbaum auf. Das Berchtesgadener Land und das Erzgebirge waren hier Vorreiter: Schaukelpferde, Nussknacker, Krippen, Puppen, Soldaten – alle im Mini-Format zum Schmuck des Baumes und fast schon ein Zitat der tatsächlichen Geschenke. Zwischen 1805 und etwa 1880 sicherte die „Berchtesgadener War“ (die Ware) mehreren Hundert Holzhandwerkern ein Auskommen, das diese zusätzlich zu ihrer Tätigkeit in der Landwirtschaft benötigten. Das Aufkommen des Blechspielzeugs – und damit auch des Blechschmucks – führte jedoch zu einem völligen Einbruch der Nachfrage nach der Holzware aus dem äußersten Süden Deutschlands. Erst seit etwa 1911, auch mit dem zunehmenden Tourismus in dieser Region, wuchs das Interesse, und heute arbeiten wieder einige Betriebe nach den alten Vorbildern.
Im Erzgebirge war es die Stadt Seiffen, die seit Mitte des 16. Jahrhunderts vom Erzabbau, und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts vom Zinnabbau lebte. Als Nebenerwerb für die harte, aber nicht immer einträgliche Arbeit wandten sich viele Bergleute schon früh dem Holzhandwerk zu, als Drechsler ebenso wie als Schnitzer. Mit dem Niedergang des Bergbaus wurde die Holzbearbeitung zum Haupterwerb und die „Seiffener Ware“ zum begehrten Exportgut. Den Bergbau haben die Schnitzer nicht vergessen, ihre Produkte sind daher weniger Miniaturmodelle von Spielzeugen oder christliche Motive als vielmehr lichtertragende Bergmänner und Engel. Diese sowie die Schwibbögen in den Fenstern haben freilich viel mit der Sehnsucht des unter Tage Arbeitenden nach Licht und Geborgenheit zu tun. Die Verbindung von Bergbau und Weihnachten kommt auch in den Weihnachtsbergen zum Ausdruck: einer bergbauähnlichen Landschaftsnachbildung, ebenfalls aus dem Erzgebirge. Bei deren Herstellung handelte es sich ursprünglich eher um einen häuslichen Brauch, dem sich schon seit dem 17. Jahrhundert in der Vorweihnachtszeit die ganze Familie mit Papier, Gips, Holz und Pappmaschee widmen konnte. Seit dem 19. Jahrhundert wurden die Weihnachtsberge nicht nur beleuchtet, sondern um weihnachtliche Szenen erweitert.
Diese sehen wir auch in der eingangs erwähnten Weihnachtspyramide, jenem karussellartigen Aufbau aus einer hölzernen Grundplatte und einem Holz-Gestänge, das sich nach oben verjüngt. Die aufsteigende Wärme von brennenden Kerzen setzt ein Flügelrad und den mit einem Stab verbundenen Teller in Bewegung. Auf diesem Teller oder der Grundplatte finden sich neben christlichen Motiven wieder solche, die die erzgebirgische Verbundenheit mit Bergbau und Natur zum Ausdruck bringen.

Lebendige Krippen und kunstvolles Handwerk
Die Verbindung von Natur mit christlichen Motiven ist auch die Grundidee der Krippen. Ihr Ursprung liegt vermutlich im Jahre 1223, als Franz von Assisi außerhalb der Kirche von Greccio, 90 km nördlich von Rom, in freier Natur eine „lebendige“ Krippe regelrecht inszenierte. Vorher hatte es bereits Krippenspiele am Altar rund um Jesus, Maria und Josef gegeben. Zu Weihnachtsspielen wurden sie um die Verkündigung an die Hirten und die Huldigung durch die Heiligen Drei Könige erweitert. Andere biblische Szenen und sogar die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies wurden in das Schauspiel aufgenommen.
Aus dem 13. Jahrhundert ist die Schrift vom Weihnachtsspiel aus Benediktbeuern in Latein erhalten. Die lebenden Akteure dort und die Tiere in Italien bei Franziskus und seinen Mitbrüdern haben die Menschen wohl so stark beeindruckt, dass sich der Nachbau von Krippen aus unterschiedlichen Materialien ausbreitete. Ab dem 18. Jahrhundert zieht die Weihnachtskrippe dann bei den Familien ein, zunächst nur in der katholischen Oberschicht, mit dem Wandel des Weihnachtsfestes zur Familienfeier dann auch bei vielen katholischen und, wenig später, sogar bei evangelischen Familien. Zwei Zentren und Zeiten des Krippenbaus lassen sich unterscheiden: „katholische“ Krippen aus Süddeutschland, Ost- und Südtirol im Barock, „protestantische“ Krippen aus Thüringen, Sachsen und Pommern im 19. Jahrhundert.
Weihnachtsmärkte seit 700 Jahren
Schwibbögen aus dem Erzgebirge, Christbaumkugeln aus dem Thüringer und Bayerischen Wald und Holzkrippen aus Südtirol fanden rasch Käufer: Im 14. Jahrhundert erhielten Drechsler und Spielzeugmacher, Korbflechter und Glasbläser das Recht, kurzzeitig Verkaufsstände auf Marktplätzen zu errichten. Und schon bald gesellten sich Zuckerbäcker und Anbieter von gerösteten Kastanien, Nüssen und Mandeln hinzu. Die ersten Weihnachtmärkte in Nürnberg, München und Dresden sind demnach schon 700 Jahre alt! Und da das leibliche Wohl auf diesen Märkten von Anfang an wichtig war, lohnt ein Blick auf regionale kulinarische Besonderheiten. Lebkuchen als exotisch gewürzte, nahezu fettfreie Dauerbackware ist die Basis vieler Spezialitäten, die uns seit dem späten 13. Jahrhundert begegnen: als Aachener Printen, Nürnberger Lebkuchen, Basler Leckerli, Pulsnitzer Pfefferkuchen, Bentheimer Moppen und als Mecklenburger Pfeffernüsse.
Oft sind es die Formen, die für die Herstellung benötigt wurden, die uns heute aus kunsthandwerklichem Interesse ansprechen. So drückte (niederländisch: „prenten“ = drucken) man beispielsweise die Aachener Printen in Holzmodeln. Die ursprünglichen Motive waren überwiegend religiöse, seit dem frühen 19. Jahrhundert fertigte man auch Formen, die französische und preußische Soldaten darstellten. Indem man diesen den Kopf abbiss, konnte man sich, wie man das ja auch im rheinischen Karneval tat, über die Besatzer lustig machen. Parallel zum Lebkuchen entwickelte sich der Stollen, ebenfalls stark gesüßt und mit getrockneten Früchten und Gewürzen verfeinert. 1457 wird er erstmals als Dresdener Christstollen erwähnt.

Brauchtum ist attraktiv
Weihnachtsmärkte und oft auch die dort angebotenen Gegenstände und Leckereien haben also eine lange Tradition. Es ist eine Tradition, die sich einer nahezu ungebrochenen Beliebtheit erfreut. Jedes Jahr kommen neue Märkte hinzu, einige sind fast sechs Wochen geöffnet, andere nur für die Dauer eines Adventswochenendes. Manche sind riesig und professionell organisiert und werden von Hunderten Reisebussen angesteuert, andere wiederum sind klein, improvisiert und überwiegend für die nächste Umgebung von Interesse. Aber aus allen spricht die Sehnsucht nach Teilhabe an Gemeinschaft, an den Ritualen der Vorfahren und danach, die Welt ein wenig heller und wärmer aussehen zu lassen. Das ist der emotionale, tatsächlich auch romantisierende Aspekt.
Der andere ist ein wirtschaftlicher. Weihnachten, ja überhaupt die ganze Weihnachtszeit mit allem, was dazu gehört, war schon immer gut für die Wirtschaft. Zu Franz von Assisi und seiner Krippe in Greccio kamen Pilger von nah und fern; sie mussten reisen, übernachten und essen – wie die Besucher der heutigen Weihnachtsattraktionen auch. Für viele Gemeinden ist Weihnachten ein einträgliches Geschäft, ein wichtiger Tourismusfaktor. Denn: Touristen beleben das Geschäft, ebenso wie das Brauchtum. Viele Bräuche haben sich nur erhalten, weil sie das Interesse auswärtiger Besucher erweckten. Und viele Bräuche wurden auch von findigen Gastwirten oder Touristikern wiederbelebt und weiterentwickelt.
Die Heiligen Drei Könige
Mit der Feier der Heiligen Nacht ist die Weihnachtszeit noch nicht vorbei. Es folgen die Rauhnächte, jene zwölf kalten Nächte zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar, in denen in vielen Regionen Unholde verjagt und Orakel befragt werden. Und dann wird es Zeit für die Epiphanie, die Erscheinung des Herrn. Auch hier wieder: eine Verbindung von profanem und liturgischem Brauch. Das Erscheinen des Erlösers im Neugeborenen kann bezeugt werden, von drei Magiern – Heiden, die erst im Laufe der Jahrhunderte zu den drei Königen aus dem Morgenland wurden.
Allerdings nahm im Mittelalter das Interesse an den Heiligen Drei Königen derart zu, dass der 6. Januar, zumindest diesseits der Alpen, nur noch Dreikönigstag hieß. Verstärkt wurde dessen Wichtigkeit durch die Überführung der angeblichen Gebeine der drei Heiligen im Jahr 1164 nach Köln, womit die Stadt zu einem der größten Pilgerziele Europas wurde – und es bis heute ist. Auch dies kann ein Anlass sein, die weihnachtliche Stube, diesen „biedermeierlichen“ Rückzugsort ins familiäre, romantische Idyll, wieder zu verlassen, um in Kirchen und auf Krippenwegen der Erscheinung des Herrn, der Bezeugung durch die Heiligen Drei Könige zu gedenken.
Und wenn sich in unserer erzgebirgischen Weihnachtspyramide zu den drei geschenkebringenden Königen auch noch ein lichttragender Bergmann gesellt, ist das Ausdruck dessen, was weihnachtliches Kunsthandwerk und Tradition ausmacht: Christliche und regionaltypische Motive, liturgische und profane Bräuche verschmelzen zu Weihnachtsbräuchen, die es wert sind, bewahrt und weiterentwickelt zu werden.
Julia Greipl
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Von Seekisten und Seeleuten 08.11.2012 Seekisten Was auf der hohen Kante lag

In den alten Zeiten der Frachtsegler musste die gesamte Habe des Seemanns in eine hölzerne Kiste passen. Manchmal liebevoll bemalt, war sie das einzige persönliche Stück, das ihn auf seinen Reisen über die Weltmeere begleitete.
-
Otto Bartning und seine Kirchen 09.03.2016 Bartning Kirchen Spiritualität in Serie

Otto Bartning gehört zu den bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Wegweisend sind seine Raumschöpfungen im Bereich des protestantischen Kirchenbaus.
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz