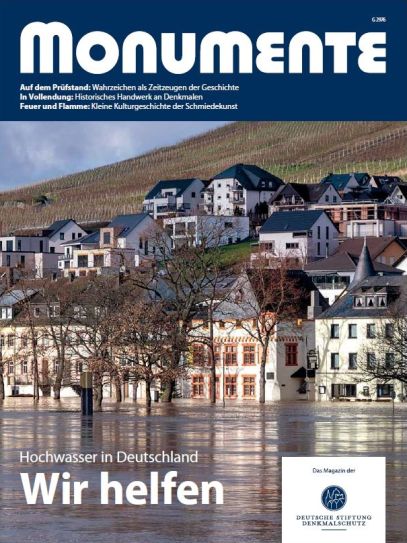Kleine und große Kirchen Archäologie 1200 Oktober 2018 A
Archäologische Entdeckung im Kloster Wedinghausen
Sensation im Stiftergrab
Grabungen im Kloster Wedinghausen in Arnsberg zeigen ein farbenfrohes und geradezu komfortables Mittelalter.
Oben auf dem Berg, mit Sicht auf die Ruhrschleife, wo selbst im Hochsommer noch ein laues Lüftchen weht, lässt es sich gut graben. Für den Archäologen Wolfram Essling-Wintzer vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) ist das ehemalige Kloster Wedinghausen im sauerländischen Arnsberg zum Lieblingsort geworden. Nicht nur wegen der exponierten Lage und auch nicht nur wegen der aufgeschlossenen Atmosphäre, die überall im Klosterareal zu spüren ist. Er ist es in erster Linie wegen „seiner“ Schätze, die aus Zeiten von vor 700 Jahren und früher stammen und die ihn glücklich machen: Zum einen handelt es sich um ein technisches Denkmal, um eine unerwartete und besonders frühe sogenannte Steinkammerheizung, zum anderen um ein von den Archäologen als sensationell eingestuftes Grab: vermutlich die Familiengrablege der Grafen von Arnsberg.
Arnsberg im Entdeckerfieber
Die archäologischen Schätze begeistern nicht nur
Essling-Wintzer. Hinter ihm steht ein ganzes Team von Akteuren – neben dem
Referat der LWL-Archäologie für Westfalen sind das die Kollegen vom
Kulturdezernat des LWL (Landschaftsverband Westfalen-Lippe), der Bürgermeister
von Arnsberg, der hiesige Propst und der Regierungspräsident. Sie alle teilen
die Begeisterung mit den Arnsbergern, die regen Anteil nehmen. Das Kloster ist
kein abgeschotteter Ort, ganz im Gegenteil: Mit mehreren Schulen, der Bücherei
und dem Stadtarchiv bildet es ein belebtes Viertel. Demnächst soll zudem eine
brasilianische katholische Organisation in den Ostflügel einziehen und mit ihr
wieder religiöses Leben. Grund für das Bistum, viel Geld zur Restaurierung des
Ostflügels bereitzustellen, gleichzeitig Glück für die LWL-Archäologen, hier
graben zu können.

Ein Archäologie-Krimi
Das Erdgeschoss des Ostflügels, bis vor Kurzem noch als
Pfarrsaal genutzt, gleicht zur Zeit einer Kraterlandschaft. Grubenförmige
Ausschachtungen wechseln sich mit Erdhügeln ab – Füllungen, die noch auf eine
sorgfältige Durchsiebung warten. Mit Hilfe der Erläuterungen von Grabungsleiter
Essling-Wintzer lichtet sich das vermeintliche Chaos, und Bilder entstehen vor
dem geistigen Auge: Ein Teil des großen Raumes war vermutlich das
Calefactorium des Klosters, das als Scriptorium genutzt worden sein könnte. Die
warme Luft der genialen Steinkammerheizung tat Papier und schreibenden Mönchen
gut. Diese Art der Steinspeicher-Heizung ist zwar schon von einigen bedeutenden
Orten des Mittelalters bekannt, aber aus dieser Zeit, nämlich Ende des 12.
Jahrhunderts, eine große Überraschung.
Im nördlichen Teil des Erdgeschosses lag der Kapitelsaal, die Versammlungsstätte der Mönche. Inmitten dieses Raums befindet sich die Sensation, die die Fachwelt elektrisiert: eine rechteckige Grube, zwei Meter lang, 80 Zentimeter breit, die zunächst unscheinbar wirkt. Erst bei näherem Hinschauen offenbaren sich an den Grubenwänden zarte Malereien. Man wusste, dass bis zur Säkularisation des Klosters 1803 hier die Tumba des Hochgrabs von Graf Heinrich II. von Arnsberg und seiner Frau Ermengardis stand. Aber erst jetzt entdeckte man, dass sich darunter noch eine Gruft befand. „Wir haben anhand von schriftlichen Quellen schon etwas vermutet, aber niemals verputzte Wände mit figürlichen, mehrfarbigen Malereien erwartet“, erzählt der Archäologe. Fresken in mittelalterlichen Grabkammern sind in Europa so gut wie unbekannt.

Warum also liegt unterhalb des Hochgrabs eine Gruft, und warum sind deren Wände bemalt? Die Spur führt ins ferne Flandern und in die nahe Klosterkirche.
Vermutet wird, dass man hier nun das Grab des Grafen Heinrich I. – Arnsberg war im 12. Jahrhundert eine bedeutende Territorialherrschaft – gefunden hat. Er hatte 1170 das Kloster Wedinghausen gegründet – der Erzählung nach als vom Kölner Erzbischof auferlegte Sühne nach der Gefangennahme seines eigenen Bruders, die dieser nicht überlebt hatte.
Heinrich I. rief zur Gründung des Klosters Prämonstratenser aus Utrecht. Im flandrischen Brügge befinden sich ebenfalls Grablegen mit bemalten Wänden. Von hier kam vermutlich die Inspiration, sich mittels christlicher Motive für die Ewigkeit zu wappnen.
Die Tumba des Hochgrabs seines Sohnes Heinrich II. und dessen Frau Ermengardis, heute in der benachbarten Propsteikirche aufgestellt, birgt einen Sarkophag. Darin liegt, laut zeitgenössischer Aufzeichnung, eine 1803 gefüllte Metallkiste mit Knochen und drei Schädeln. Hat man damals die sterblichen Überreste mehrerer Generationen der Grafenfamilie, nämlich das, was man in der Grablege gefunden hat, einfach zusammengeworfen?

Eine Rekonstruktion des Kapitelsaals stellt sich nach aktuellem Stand folgendermaßen dar: Im Kapitelsaal tagen die Mönche um das Grab der Stifterfamilie von Arnsberg. Eine Kapelle, 1275 an den Saal angebaut, liegt in einer Linie mit der Grablege und unterstreicht deren Bedeutung. Ab ungefähr 1320 steht auf ihr die Tumba mit den zwei steinernen Liegefiguren auf der Grabplatte. Um diese Zeit entstehen auch die Malereien der Gruft.
Die räumliche Anordnung hat einen Sinn: Auf geschickte Art wird für ein adäquates Gedenken an die Familie als Stifter des Klosters Wedinghausen und damit für ihr Seelenheil gesorgt. Nachgewiesen ist, dass in allen Generationen der Familie großzügige Schenkungen und Stiftungen für das „Hauskloster“ gegeben wurden, eine Art Jenseitsvorsorge. Seit 1364 findet zudem zweimal im Jahr das „Grafenbegängnis“ statt: Seelenmessen, die mit einem Essen für den Stadtrat sowie für die Ehefrauen der Ratsmänner verbunden sind und die im Kapitelsaal abgehalten werden. Fenster vom Kreuzgang in den Kapitelsaal lassen das gemeine Volk teilhaben an der Zeremonie – eine Inszenierung, die im Vertrauen auf das ewige Leben fußt und tief in das mittelalterliche Weltenverständnis blicken lässt.
Stifter haben das Kloster Wedinghausen vor 850 Jahren gegründet, Stifter spielen auch heute noch eine entscheidende Rolle. Denn die detektivische Arbeit der Archäologen braucht Geldgeber. Hier kommt unter anderem die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Form einer von ihr verwalteten treuhänderischen Stiftung ins Spiel: Die Emil und Hanna Flatz-Stiftung unterstützt mit ihren Erträgnissen die archäologischen Maßnahmen. Sie fördert die behutsame Freilegung der Grabstätte, die Untersuchung des Verfüllmaterials und die Sicherung der Farbfassungen der Malereien. Arbeiten, die in den nächsten Monaten weitergeführt werden.

Die nächsten Schritte
1803 hatte man beim Umbau des Klosters ohne Rücksicht auf
die Gruft einen Pfeiler in den Boden gesetzt. Um eventuell noch tiefer graben
zu können, muss mit Hilfe erfahrener Ingenieure das Fundament des Pfeilers
entfernt werden. Man weiß, dass bereits vor der Klostergründung an dieser
Stelle der gräfliche Hof Wedinghausen mitsamt einer Kapelle existiert hat, in
der schon die Vorfahren bestattet wurden. Jeder Zentimeter Grabung kann
Erhellendes zu Tage bringen.
Das Hochgrab Heinrichs II. und seiner Frau soll geöffnet werden, um in einem Speziallabor zu überprüfen, ob die DNA der Knochen mit der der Knochenfragmente, die man in der Gruft gefunden hat, übereinstimmt. „Die moderne Archäologie arbeitet eng mit den Naturwissenschaften zusammen“, so Professor Michael Rind, Direktor der LWL-Archäologie für Westfalen. „Wir erhoffen uns Antworten auf Fragen etwa zu Alter und Gesundheitszustand der Bestatteten.“ Wie in einem Puzzle sollen die Erkenntnisse zu einem Bild zusammengesetzt werden.
Was passiert mit der Grabung?
Seit Jahrzehnten ist man unter Archäologen im Konsens: Der
beste Fund ist der in situ erhaltene Fund. Wie man künftige Generationen an
diesem Kulturgut teilhaben lassen kann, muss gut überlegt sein. In Erwägung
gezogen wird zum Beispiel ein digitales Museum: Die originale Fundstelle wird
wieder verschlossen und damit geschützt. Vor Ort, nah an der Aura des
Historischen, könnten dann per Smartphone und App die Funde erlebbar gemacht
werden.

Aber soweit ist man noch nicht. Wolfram Essling-Wintzer sieht sich im Raum um und freut sich auf die bevorstehenden Arbeiten: „Das Tolle sind die Geschichten, die man hier erzählen kann: Heinrich I. wird einige Jahre vor seinem Tod in seinem eigenen Kloster Laienmönch, was er vermutlich schon wusste, als er das Kloster stiftete. Deshalb hat er einen außergewöhnlichen Komfort sichergestellt: eine Steinkammerheizung, im ausgehenden 12. Jahrhundert etwas wirklich Besonderes. Die gab es nur in Kaiserpfalzen, für den Hochadel und in ganz wichtigen Reichsklöstern. Er kannte so etwas, weil er sehr weltläufig war und Beziehungen zu den wichtigsten Personen wie Kaiser Friedrich Barbarossa hatte.“
Solche Zusammenhänge herzustellen, Steine lebendig werden zu lassen, und sie auch dank neuester Technologie mit Geschichte zu füllen – das ist Archäologie. Um die Leidenschaft für die Materie aus dem inneren Kreis der Fachleute hinauszutragen, braucht es engagierte Verantwortliche. Arnsberg hat das Glück, sie zu haben.
Beatrice Härig

Bewegte Zeiten in Berlin: Große Archäologie-Ausstellung
Seit dem 21. September ist im Berliner Gropius-Bau die Ausstellung „Bewegte Zeiten: Archäologie in Deutschland“ zu sehen. Es handelt sich um eine Sonderausstellung des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin in Kooperation mit dem Verband der Landesarchäologen anlässlich des Europäischen Kulturerbejahres 2018.
Aufsehenerregende Funde, die in den letzten 15 Jahren in Deutschland gemacht wurden, zeigen, dass es innerhalb Europas schon immer Mobilität und Austauschprozesse gegeben hat. In vier großen Themenblöcken werden sie mit den neuesten Forschungsergebnissen präsentiert: Es geht um die Bewegung von Menschen, Sachen und Ideen.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz freut sich, durch die Arbeit der Jugendbauhütte Lübeck direkt an der Ausstellung beteiligt zu sein: Die Hanse dient als Beispiel eines frühen, bis heute bestaunten europäischen Bundes. Grabungen im Lübecker Gründungsviertel haben gezeigt, dass schon sehr früh ein standardisierter Holzbau für die schnelle Bebauung der Mitte des 12. Jahrhunderts gegründeten Stadt eingesetzt wurde. Die Freiwilligen der Jugendbauhütte rekonstruieren während der laufenden Ausstellung in Berlin vor Publikum einen der 40 gefundenen Keller in Originalgröße und zeigen, wie durchdacht die Keller auf die Lübecker Hanse-Kaufleute und die Lagerung ihrer Waren zugeschnitten waren.
Sie arbeiten dabei unter möglichst authentischen Bedingungen nach historischem Vorbild und machen damit archäologisches Erbe erlebbar. Die originalen Überreste der Keller bleiben übrigens unter der Neubebauung des Gründungsviertels erhalten.
Beatrice Härig
Bewegte Zeiten: Archäologie in Deutschland
Bis 6. Januar 2019 im Martin-Gropius-Bau,
Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin
Öffnungszeiten: Mi–Mo 10–19 Uhr, Di geschlossen
Spenden für das Kloster Wedinghausen
Auch kleinste Beträge zählen!
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Die neue Lust am Bungalow 08.11.2012 Bungalows Die Leichtigkeit des Steins

Fast 17 Millionen Dollar. Das ist auch für das Auktionshaus Christie's keine alltägliche Summe. Bei 16,8 Millionen Dollar ist im Mai bei einer Auktion in New York für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst der Zuschlag erfolgt, und zwar für - und das ist ebenso ungewöhnlich - ein Bauwerk. Nicht einmal ein besonders großes.
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther 04.07.2017 Ulrich Müther Hyparschalen

Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
Lesen Sie 0 Kommentare anderer Leser
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz