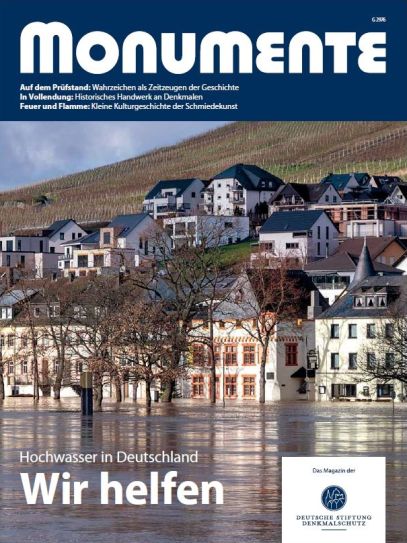Stile und Epochen Herrscher, Künstler, Architekten April 2018 K
Auf der Suche nach Identität
Baukultur nach dem Dreißigjährigen Krieg. Eine Skizze.
Mit dem Westfälischen Frieden 1648 wurde eine neue politische Ordnung geschaffen. Welche architektonischen Spuren lassen sich aus dieser Zeit finden?
Vor 400 Jahren, am 23. Mai 1618 stießen protestantische Abgesandte zwei katholische Ministeriale des Kaisers aus einem Fenster des Prager Hradschins. Es war der Gipfel der Erbitterung seitens der böhmischen Stände, dass trotz der vom Kaiser zugesagten Privilegien Maßnahmen zur Rekatholisierung stattfanden. Der spektakuläre Angriff auf der politisch-religiös aufgeheizten Bühne geriet zum Fanal, das als Beginn des Dreißigjährigen Krieges in die europäische Geschichte einging.
Der Prager Fenstersturz blieb umso mehr in der kollektiven Erinnerung, weil die beiden Männer kaum verletzt im Burggraben landeten. Im Gegensatz zu den Millionen von Menschen, Soldaten wie Zivilisten, die in der nachfolgenden, drei Jahrzehnte währenden Kriegszeit getötet wurden.
Eigentlich bestand der Dreißigjährige Krieg aus mehreren Kriegen, die in verschiedenen Regionen unterschiedlich massiv wüteten. Durch die Gegenreformation hatten sich die konfessionellen Gegensätze im Heiligen Römischen Reich erneut verschärft – konkret waren es die unversöhnlich einander gegenüberstehenden Bündnisse der sogenannten protestantischen Union und der katholischen Liga.
Ebenso hatte sich die Beziehung zwischen den Reichsständen und der Habsburger Monarchie dramatisch verschlechtert. Zum malträtierten Kriegsschauplatz wurden die deutschen Territorien jedoch erst, als die europäischen Mächte in den Kampf um die Vorherrschaft eingriffen. Die Zerwürfnisse spielten sich auf mehreren Ebenen ab: Katholiken gegen Protestanten, Fürsten gegen Kaiser, die Monarchien Österreich und Spanien gegen Frankreich und Schweden. Eine unheilvolle Mischung aus Machtwillen und Glaubensüberzeugungen, die zum Böhmisch-Pfälzischen Krieg 1618–23, zum Niedersächsisch-Dänischen Krieg 1625–29, zum Schwedischen Krieg 1630–35 und schließlich zum Schwedisch-Französischen Krieg 1635–48 führten.
Dann endlich fanden die kriegsmüden Parteien zur Diplomatie zurück und balancierten mühsam die politischen Machtverhältnisse aus. Diese mündeten in zahlreichen Einzelverträgen, heute bekannt als der Westfälische Friede von 1648. Zu den wichtigsten Folgen gehörte, wie der Historiker Johannes Burkhardt es nennt, die deutsche Doppelstaatlichkeit. Sie beruht auf zwei Ebenen: Auf der oberen agieren Kaiser und Reichsstände, deren Landesfürsten auf der unteren Ebene ihre inneren Belange selbst regeln. Das Reich bestand nunmehr aus Einzelstaaten – souverän, aber zum großen Teil ausgezehrt.

Während des Dreißigjährigen Krieges brachten in vielen deutschen Gebieten die Phasen relativer Ruhe der Bevölkerung nur trostloses Elend. Sie litt unter den Einquartierungen der Soldaten, es herrschte Hungersnot, Seuchen wie die Pest breiteten sich todbringend aus. Zudem zogen marodierende Söldnertruppen, hungrig und unterbezahlt, durch die Lande, denen man sich häufig erbittert zu erwehren versuchte. Frustration und Gewaltbereitschaft arteten vielerorts zu Gräueltaten aus, die jeder Beschreibung spotten. Die Zahl der Toten geht in die Millionen. Die Bevölkerung nahm in manchen Gegenden so stark ab, dass ganze Landstriche verödeten und sich über Generationen nicht davon erholten. Besonders tief zogen sich die Kriegsspuren durch Gebiete wie Mecklenburg, Brandenburg, Thüringen, die Pfalz, den Niederrhein und Teile von Württemberg. Andere Fürstentümer wie Bayern oder Sachsen waren durch die Kriegskosten hoch verschuldet. Die Wirtschaft lag am Boden.
Die großflächige, mutwillige Zerstörung von Siedlungen und Bauwerken – wobei noch am ehesten die soliden, steinernen Schlossbauten und Herrenhäuser verschont blieben –, hatte großen Anteil am Leid der Bevölkerung. Als grausamer Höhepunkt gilt das Massaker im protestantischen Magdeburg. Die Stadt bildete im Schwedischen Krieg einen strategischen Punkt an der Elbe. Am 20. Mai 1631 machten die kaiserlichen Truppen unter den Feldherren Tilly und Pappenheim die Stadt dem Erdboden gleich. Erst im 19. Jahrhundert erlangte Magdeburg wieder eine nennenswerte Größe. Selbst Tilly soll über das Wüten seiner Soldaten erschrocken gewesen sein, Papst Urban VIII. hingegen begrüßte die Ausrottung des „Ketzernestes“. „Magdeburgisiert“ zu werden, war seitdem ein gefürchtetes Schreckgespenst, obwohl die Feldherren bei Belagerungen auf Eroberung und nicht auf Vernichtung aus waren.
Niedergang und Aufbau gingen Hand in Hand. Bauvorhaben wurden in den verschiedenen Territorien weiterhin je nach Kriegs- und Geldlage durchgeführt. Viel Geld investierte man in den Festungsbau, der oft erst zum Abschluss kam, wenn die Kriege vorbei waren. Ulm etwa blieb dank seiner neuen Bastionen uneinnehmbar, und im Bistum Mainz ließen wegen der zentralen Lage an Rhein und Main sogar die schwedischen Besatzer weiter an den Festungswerken bauen.
Im bürgerlichen Wohnbau blieb man oft den Fachwerkkonstruktionen und der bewährten Formensprache der Spätgotik treu. Vermutlich, weil die Handwerker mit Maßen und Konstruktionen, mit Material und Bauschmuck vertraut und entsprechend routiniert in der Ausführung waren. Jeder Bauauftrag brachte der notleidenden Bevölkerung Arbeit und damit Lohn und Brot. Mindestens so wichtig war der Wiederaufbau zerstörter Kirchen. In Mecklenburg ließen die adeligen Gutsbesitzer Dorfkirchen selbst in fast ausgestorbenen Gegenden wiedererrichten, meist in einfacher Form aus Fachwerk, das auf die alten Feldsteinmauern aufgesetzt werden konnte. Die unzähligen Kirchlein sollten ein tröstliches Zeichen für die Überlebenden sein, dass Gott sie nicht verlassen hatte.
Doch ebenso wurden an den Gotteshäusern die politisch-religiösen Haltungen demonstriert: Jeweils nach ihrer Konfession ließen die Besatzer und später die Landesherren sie wieder aufbauen und ausstatten. Die Protestanten trachteten danach, sich mit einem eigenen Typus vom althergebrachten katholischen Kirchenbau abzusetzen. 1649 befand der in Italien ausgebildete Ulmer Bauingenieur Joseph Furttenbach einen schnörkellosen Nutzbau als geeignet: einen einfachen Rechtecksaal ohne Gewölbe wegen der besseren Akustik, ohne Stützen wegen der besseren Sicht und mit freihängenden Emporen wegen des vergrößerten Platzangebots. Zuvor hatte lange die spätgotische Kirche von Schloss Hartenfels in Torgau als Vorbild gedient, weil Martin Luther sie 1544 eingeweiht und vermutlich Einfluss auf ihre Bauform genommen hatte.
Mit der Anerkennung der unterschiedlichen Konfessionen im Reich kam nach dem Dreißigjährigen Krieg der Renaissance-Gedanke vom Zentralbau erneut auf. Der Schweriner Baumeister Leonhard Christoph Sturm (1669–1719) bereitete dem eigenständigen protestantischen Kirchentypus den Weg mit einem quer zur Hauptachse ausgerichteten, rechteckigen Saal – Grundform der späteren Querkirchen. Ob oval, polygonal, rechteckig oder kreuzförmig, das liturgische Zentrum liegt bei Querkirchen mittig an der Breitseite, sodass sich die Gemeinde um das liturgische Geschehen versammeln kann. Oft gaben protestantische Landesherren sie in Auftrag und platzierten die fürstlichen Logen nicht wie üblich gegenüber, sondern nahe der Kanzel.
In den katholisch dominierten Gebieten, vor allem des süddeutschen Raums, zeigte sich das gegenreformatorische Streben, indem der Bau repräsentativer Ordens- und Wallfahrtskirchen vorangetrieben wurde. Hier ist der italienische Einfluss in der Formensprache besonders deutlich, zumal es nach dem Westfälischen Frieden zunächst italienische Baumeister waren, die namhafte Bauaufträge erfüllten. Bereitwillig unterstützt vom Jesuitenorden, wurden sie häufig als Wandpfeilerbauten nach dem Vorbild der 1584 fertiggestellten Jesuitenkirche Il Gesù in Rom gestaltet. Eines der frühesten, barocken Bauwerke nördlich der Alpen ist die Theatinerkirche in München, die ab 1663 Agostino Barelli und Enrico Zuccali ausführten.
Geprägt vom damals gut 200 Jahre zuvor entwickelten humanistischen Geistesgut galten die italienische Kultur und Renaissance-Baukunst noch immer als Ideal, auf dem auch der nachfolgende Barockstil basierte. Um den Gedanken des Zentralbaus kreisend, wurden mit Elementen aus der römischen Antike wie Pilaster, Säulen, Gebälk und Tympanon und mit vergleichsweise sparsamem Dekor eigenständige sakrale und profane Bauwerke geschaffen. In Körper und Proportionsgefühl bezog man sich dabei auf das menschliche Maß, um einen eigenen „lebendigen Organismus“ zu formen. Mit dem auf den Menschen zentrierten Blick war in der Renaissance der Baumeister zum Künstler geworden, trat der weltliche mit mindestens so ambitionierten Vorstellungen neben den geistlichen Auftraggeber.

Doch nicht allein der Sakralbau lag im Fokus, sondern ebenso der repräsentative Residenzbau. Insbesondere in den protestantischen Territorialstaaten schenkte man ihm besondere Aufmerksamkeit. Italienische und französische Einflüsse hielten sich die Waage, wobei letztlich die offene französische Dreiflügelvariante gegenüber dem geschlossenen Bautypus bevorzugt wurde. Vielleicht lag den protestantischen Potentaten die politische Einstellung der Franzosen näher, waren sie doch entschiedene Gegner der habsburgischen Machtansprüche.
Es hatte seine Zeit gebraucht, bis in den deutschen Territorien die Intention der italienischen Renaissance erfasst und in eigener Interpretation umgesetzt wurde. Man denke etwa an die sogenannte Weserrenaissance des 16. Jahrhunderts. Unzählige Traktate waren zur antiken und zeitgenössischen Architektur im Umlauf und dienten als willkommene schriftliche Vorlagen. Der Dreißigjährige Krieg brachte eine Zäsur, aber zum Erliegen kam das Bauschaffen nicht. Das Schloss von Plön etwa, Residenz der Herzöge von Schleswig-Holstein-Plön, zählt zu den wenigen Bauvorhaben, die 1633–36 vom Kriegsgeschehen ungestört durchgeführt werden konnten. Je nachdem, wer die Baumeister und Künstler waren, in welchen Städten und an welchen Höfen Europas sie ihr Auge geschult hatten, in welchen bildungs- und geistesgeschichtlichen Kreisen sich die Bauherren bewegten und in welchem Netzwerk sie „ihre“ Künstler empfahlen, entstanden Bauwerke, die auf der Formensprache der Renaissance beruhen, in den Barock hineinspielen und doch eigenständig in ihrem Erscheinungsbild sind. Die Architekturhistoriker tun sich schwer, für das territoriale Bauschaffen des 17. Jahrhunderts in Deutschland einen allgemeingültigen Überbegriff zu finden.
Alles in allem war es eine verhaltene Zeit in der deutschen Baukultur. Im Bauschmuck hielt man sich eher zurück und beeindruckte auf den ersten Blick mit symmetrischer Strenge und steinerner Harmonie, wie dies zum Beispiel Schloss Friedenstein in Gotha demonstriert. Dennoch herrschte bei den Landesfürsten ein Baubestreben, als suche man angesichts des neuen förderalen Miteinanders im Reich nach einer eigenen Identität.
Mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts brach dann aber eine wahre Bauleidenschaft aus. Kunst, Kultur und Mäzenatentum blühten erneut auf. Unter den Baumeistern fanden sich nunmehr auch wieder deutsche. Es war eine neue, erste Generation von Baumeistern, unter denen Namen auftreten wie Andreas Schlüter (Berliner Schloss 1699–1706), Matthäus Pöppelmann (Zwinger in Dresden 1711–28), Balthasar Neumann (Würzburger Residenz 1720–44) und Dominikus Zimmermann (Wallfahrtskirche in der Wies bei Steingaden 1745–54). Mit der festlichen Formensprache des Barock taten sie dem repräsentativen Anspruch ihrer geistlichen und weltlichen Auftraggeber – nunmehr überzeugte Zeitgenossen des landesherrlichen Absolutismus – in Vollendung Genüge.
Christiane Rossner
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Die neue Lust am Bungalow 08.11.2012 Bungalows Die Leichtigkeit des Steins

Fast 17 Millionen Dollar. Das ist auch für das Auktionshaus Christie's keine alltägliche Summe. Bei 16,8 Millionen Dollar ist im Mai bei einer Auktion in New York für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst der Zuschlag erfolgt, und zwar für - und das ist ebenso ungewöhnlich - ein Bauwerk. Nicht einmal ein besonders großes.
-
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther 04.07.2017 Ulrich Müther Hyparschalen

Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz