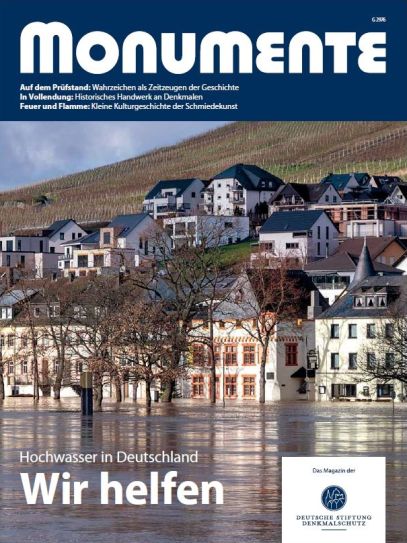Öffentliche Bauten Nach 1945 Material Denkmale in Gefahr Restaurierungstechniken Februar 2018 B
Der Brutalismus und die digitale Denkmalwelt
Betonmonster
Kraftvoll, kompromisslos und und oft konträr beurteilt - während für viele Bauwerke des Brutalismus der Abriss diskutiert wird, formiert sich gleichzeitig eine Fangemeinde zu ihrer Bewahrung,
Er ist da. Alle Medien haben ihn in den letzten Monaten gebracht: die ehrwürdigen Zeitungen, die Hochglanzarchitekturmagazine. Er hat es in die Hauptnachrichten des Fernsehens geschafft und wurde im Hörfunk besprochen. Der Brutalismus hat sich in alle Kanäle gewuchtet. Eine Architektursprache, die 1953 erstmals benannt wurde, die von Anfang an heftig diskutiert, zu Grabe getragen und wiederbelebt wurde und bis etwa 1980 in Profan- wie Sakralbauten ihren Ausdruck fand. Um dann schließlich vor einigen Jahren wiederentdeckt zu werden. Eine diffuse Begrifflichkeit, und mit ihr ein Stück Architekturgeschichte, die zurzeit neu eingepasst wird. Es geht um die Sichtbetonbauten, die mit ihren kompromisslosen, die Konstruktionen offenlegenden, großen Formen seit Mitte der 1960er in der ganzen Welt die Städte prägten.

Denkmalpflege 3.0
Der Brutalismus rollt das Feld sozusagen von hinten auf: Während die meisten Menschen brutalistische Bauten in ihren Städten als gegeben hinnehmen, zu übersehen versuchen – was durch ihre schiere Größe schlechterdings sehr schwierig ist – oder gar hassen, hat andere eine fast schon euphorische Liebe zu ihnen erfasst. Und diese Passion ist so international wie sie regional ist. 2007 hat sich über Facebook eine Community gebildet, die sich für die Erhaltung der Betonbauten einsetzt. Initiatorin war die „Brutalism Appreciation Society“, die Gesellschaft zur Wertschätzung des Brutalismus, in Großbritannien. Sie hat heute mehr als 50.000 Follower. Allein seit 2015 verdoppelte sich ihre Anzahl. Schließlich nahm sich das Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt am Main (DAM) zusammen mit der Wüstenrot Stiftung dem Brutalismus an. Adaptiert haben die Macher aber nicht nur die Beachtung der Architekturform selbst, sondern auch das Thema als Internetphänomen: Vor zwei Jahren gründeten sie mit #SOSBrutalism eine Social-Media-Plattform, an der jeder mitwirken darf und in die jeder eingebunden wird. Unermüdlich sucht die wachsende Brutalisten-Fangemeinde weltweit nach Exemplaren jener exaltierten Architektur und schickt Fotos von ihnen quer durch die Internet-Welt und insbesondere auf die #SOS-Seite. Sie teilt ihre Leidenschaft über die Bilder.


Monster mit Seele
Und sie erklärt natürlich das Phänomen Brutalismus. „Wir haben den Versuch unternommen, den Brutalismus neu zu definieren“, beschreibt Elser seinen Ansatz. Denn klar abgrenzen, in Formen fest umreißen lässt sich der Brutalismus nicht. Zeitlich werden Gebäude aus den Jahren von etwa 1960 bis 1980 zugeordnet, typische Merkmale sind eine drastische und schwere Formensprache, und eine radikale, großflächige Materialsichtigkeit. Béton brut, zu Deutsch Sichtbeton, ist Namensgeber des Brutalismus und ein Ausdruck, den Le Corbusier geprägt hat. Seine Kirche Sainte-Marie de La Tourette von 1960 in Eveux wird von manchen als eine Art endgültiges Initial des Brutalismus angesehen, von einigen gar als poetischer Brutalismus bezeichnet.
Poetisch sind allerdings nur wenige der brutalistischen Bauwerke. Die Ausstellungsmacher bemühen sich zwar, die Bezeichnung „brut“ im Sinne des herben Champagners und nicht als „brutal“ schmackhaft zu machen. Brut oder brutalistisch sind die Bauwerke deshalb, weil der Beton roh und als reines Material verwendet wird. Dass im Deutschen aber zwangsläufig Brutalität assoziiert wird, ist von der Begrifflichkeit her nicht gewollt, jedoch angesichts der Gebäude oft verständlich: Die „Betonmonster“ schüchtern ein, durch ihre reine Größe, durch ihre wie Gebirge aufgetürmte Masse. Gefällig sind sie nicht. Sie brauchen, um von ihren Fans begeistert als brutalistisch erkannt zu werden, eine gewisse Attitüde: futuristisch, mutig, manchmal dem Wahnsinn nahe. Seelenlose Klötze ohne Anspruch auf Aussage tauchen in der Datenbank der SOS-Brutalisten nicht auf. Brutalismus ist weniger ein Stil als eine Haltung.

Es ist eine Kunstgeschichtsschreibung per Fotos. Und es ist eine Art Denkmalpflege 3.0. Das Team des Frankfurter Museums um Oliver Elser moderiert die Zuschriften, ordnet, sortiert aus und stellt sie ins Netz ein. Mehr als 1.100 Bauten sind so inzwischen gesammelt. Eine Art Ampelsystem stuft die Betonbauten in verschiedene Gefährdungsstufen ein. Die „Rote Liste“ verzeichnet mittlerweile 120 Gebäude, die von Abriss oder Umgestaltung bedroht sind. Seit November 2017 wird im DAM zusätzlich in klassischer Manier, nämlich in einer Ausstellung, das Thema vorgestellt: Ihr Titel „SOS Brutalismus. Rettet die Betonmonster“ mit dem Untertitel „Eine internationale Bestandsaufnahme“ bringt Ansatz und Intention auf den Punkt: Sie ist im eigentlichen Sinn eine „Ausstellung zu Fragen der Denkmalerhaltung“, meint Kurator Oliver Elser.

Brutalismus funktioniert besonders gut über Fotos und ist somit ein Star des Zeitgeistes. Besonders auf Bildern mit harten Anschnitten kommen die skulpturalen Qualitäten gut heraus. Und an ihnen lässt sich auch die besonders sorgfältige Behandlung des Betons erkennen. Das Spiel mit den Spuren der Schalungsbretter, der Einsatz unterschiedlicher Körnungen, das nachträgliche Herausarbeiten von einer Art Lisenen im Ortbeton mit Hammer und Meißel huldigt auf feine Weise dem Material. Fotografien in edlem Schwarz-Weiß setzen die Kolosse und den Beton ästhetisch in Szene.
Die Realität sieht oft anders aus. Wohl kaum einer wird behaupten, dass brutalistische Gebäude ausnahmslos eine Bereicherung der Umgebung darstellen. Neben ihrer provokanten Form ging mit ihrer Errichtung – und hier kommt das Wort brutal in seiner Bedeutung voll zur Geltung – häufig die bewusste Zerstörung alter Bausubstanz einher. Ihre „Monsterhaftigkeit“ beruht auch darauf, dass sie wie Außerirdische mit voller Absicht und ohne Bezug in gewachsene Strukturen gesetzt wurden. Zudem ist Beton ein empfindliches Material, das schnell verdreckt. Sichtbeton stellt sich nur kurze Zeit als die reine graue Oberfläche dar, an die Architekten beim Entwurf gern denken.
Hinter den brutalistischen Gebäuden stehen gute Absichten und historische Begründungen. Als öffentliche Gebäude in Ost wie West und in vielen regionalen Besonderheiten weltweit sollten sie als „soziale“ Architektur allen Bürgern dienen. Im deutschen Wiederaufbau formulierten sie gerade im Schul-, Theater- oder Rathausbau eine klare Aussage gegen die Formen der vergangenen Epochen. Sie dienten der Selbstdarstellung fortschrittlich gedachter Staaten: ehrlich und direkt. Der Zahn der Zeit hat sie dann oft zu Schmuddelkindern werden lassen, verwahrlost, trostlos und wenig geliebt – was wiederum die Subkultur anzieht. Die örtliche Skater-Szene zum Beispiel findet neben idealen baulichen Voraussetzungen für ihre Kunststücke eine adäquate Kulisse.
Doch man sollte sich nicht täuschen: Die neue Anhängerschaft der Betonburgen ist breit aufgestellt. Sie ist bunt gemischt und vom Alter her nach oben offen. Stark vertreten ist die Generation, die in ihnen die Szenerie ihrer Kindheit, ihrer Stadtbücherei- und Hallenschwimmbadbesuche oder ihrer Studienzeit wiederfindet.

Brutalistische Sakralbaukunst
Anspruchsvolle und fordernde Formen werden bei Sakralbauten leichter akzeptiert, weil ihr skulpturaler Charakter der spirituellen Nutzung angemessen erscheint. Die Kirchen eines Gottfried Böhm – der Mariendom im bergischen Velbert-Neviges etwa – gelten als hohe und unbedingt zu erhaltende Baukunst, sie sind geradezu Architektur-Erlebnisse. Er, der auch Bildhauerei studiert hatte, bediente sich bei seinen Bauwerken der expressionistischen Bildsprache, aber ebenso sind sie in ihren Formen und in ihrem Material in weiten Teilen bedingungslos brutalistisch.
St. Agnes in Berlin-Kreuzberg ist die strengste unter den brutalistischen Kirchen in Deutschland: 1964–67 von Werner Düttmann entworfen, zeigt sie – fast fensterlos, unnachgiebig rechteckig und karg – Tonnen reinen Betons, ohne den Betrachter zu erdrücken. Im Inneren steigert sie den sinnlichen Effekt der mit Zementputz strukturierten Wände durch Schmucklosigkeit und riesige Dimensionen. Wie sehr das Ästheten heute wieder anzieht, zeigt ihre Nutzung seit 2012 durch die renommierte Galerie König. Nicht nur Kunstausstellungen, auch andere Veranstaltungen funktionieren überzeugend in ihren Räumen – Events, bei denen die Architektur immer eine eigene Rolle spielt, nie nur Hülle ist. Hier hat der Brutalismus die Wiederauferstehung zum gefeierten Star geschafft.

Das gilt bislang nur für die wenigsten Gebäude dieser Architekturform. Im DAM am Frankfurter Museumsufer befindet sich der Besucher nicht nur wegen der Ausstellung mitten im Thema: Der Blick geht auf die großen Kräne am Römer jenseits des Mains. Dort baut man gerade – einmalig bisher in Europa – die „gotische“ Altstadt wieder auf. 35 neue Gebäude entstehen als „schöpferische“ Neubauten. Abgerissen wurden dafür Paradebeispiele brutalistischer Architektur, das Historische Museum von 1972 und das Technische Rathaus von 1974. 2011 waren die Betongebilde nur noch Geschichte. Die Sehnsucht nach dem Kleinteiligen und dem Gemütlichen, nach einer übersichtlichen Welt, hat die Betonmonster in die Knie gezwungen.
Aber das Leben ist im ewigen Fluss, und so manches wiederholt sich in der Geschichte. So wie in den 1960er-Jahren von vielen die historistische Pracht, zumindest das was davon übriggeblieben war, verachtet, abgerissen, „bereinigt“ wurde, so sehr lehnte man wenige Jahrzehnte später ihren Ersatz ab, die brutalistischen Gebäude. Sie, die als Anti-Haltung zur Architektur der Vorväter gedacht waren, erfuhren und erfahren massive Ablehnung. Jetzt kämpfen wiederum nicht wenige um diese Hinterlassenschaften und um eine Neubewertung. Die Bewegung formiert sich virtuell im Internet. Ganz real aber müssen mühsame Diskussionen geführt werden. Dutzende sanierungsbedürftige Stadttheater, Schwimmbäder und Schulen stehen zur Disposition. Viele Städte müssen zu einem baulichen Erbe Entscheidungen treffen, das als Vermittler einer historischen und ästhetischen Aussage noch nicht in der Gesellschaft angekommen ist. Die Aktualität ist frappierend.
Beatrice Härig

Der „Mariendom“ in Velbert-Neviges und das Problem mit dem Beton
Beton: ein Baustoff, der polarisiert und landläufig als eine Erfindung des 20. Jahrhunderts angesehen wird. Die wahre Geschichte sieht anders aus. Von den Römern als bahnbrechendes Baumaterial erstmals aus Wasser, Zement, Steinen und Sand angerührt, ermöglichte erst er die bis heute bewunderten Monumentalbauwerke der Antike. Selbst die Kuppel des Pantheons in Rom wurde in Beton ausgeführt. Im Mittelalter ging dieses Wissen verloren. Erst ab 1800 experimentierte man wieder mit dem Baustoff. Die bis dahin fehlende Zugfestigkeit wurde ab Mitte des 19. Jahrhunderts durch armierten Stahl erreicht. Stahlbetonbauten prägten das Bild der frühen Moderne und noch viel mehr das der Nachkriegszeit. Heute versucht man umweltgerechtere Methoden der Betonherstellung zu finden und vor allem seine Haltbarkeit zu verbessern. Die fehlende Beständigkeit ist nämlich das große, unerwartete Problem der Betonkonstruktionen. Unter anderem die Luftverschmutzung macht ihnen zu schaffen. Sie lässt den Stahl rosten, der dann wiederum den Beton auseinandersprengt. Betonsanierung ist eines der großen Themen der Denkmalpflege geworden, eine Patentlösung wurde bis jetzt nicht gefunden.


Die Wallfahrtskirche Maria, Königin des Friedens, auch Mariendom genannt, in Neviges bei Wuppertal dient gerade als aufwendig angelegtes Versuchsprojekt. Sie ist ein Meisterwerk Gottfried Böhms und eine Ikone der Nachkriegsmoderne. Das „Felsenmeer“ aus Beton ist sichtbar in die Jahre gekommen. Das Dach war schon kurz nach seiner Erbauung 1968 undicht. Deshalb versah man die Dachflächen gegen Ende der 1980er-Jahre mit einer hellen Kunststoffbeschichtung. Diese wurde bald unansehnlich. Zudem sammelte sich weiterhin Wasser in den Rinnen und Kehlen des Betondaches. Blei kam partiell als Deckungsmaterial ohne überzeugenden Erfolg zum Einsatz.

Eine Expertengruppe unter der Leitung von Peter Böhm, Sohn des Architekten, hat nun im vergangenen Jahr ein Teilstück des Daches saniert. Prämisse war, die Betonsichtigkeit uneingeschränkt zu erhalten. Man entschied sich für einen carbonfaserverstärkten Spritzbetonauftrag. Dieser weist eine extrem hohe Zugfestigkeit auf, und er verteilt die unvermeidlichen Konstruktionsrisse so fein, dass kein Wasser eindringen kann. Bei einem Teilstück des 300 Quadratmeter großen Daches wurde das Epoxidharz abgenommen, das Dach sandgestrahlt und der Stahlbeton saniert. Drei Lagen Spritzbeton mit zwei Einlagen Carbonfasergewebe sollen nun das Dach optimal witterungsbeständig aufrüsten. Materialforscher der RWTH Aachen hatten umfangreiche Versuchsreihen durchgeführt und beobachten das Ergebnis weiter aufmerksam. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz förderte diese Betonsanierungsmaßnahme mit 200.000 Euro. Ebenso wie die beteiligte Wüstenrot Stiftung hofft sie auf neue Erkenntnisse für die Denkmalpflege im Bereich der Betonsanierung.
6.000 Plätze bietet der Mariendom – mit einer gigantischen Dachfläche, von der erst ein Bruchteil saniert ist, streckt er seine Spitzen in ein neues Zeitalter.
Beatrice Härig
Spenden für die weitere Restaurierung des Mariendoms
Auch kleinste Beträge zählen!
Informationen
Projekt: www.sosbrutalism.org
Ausstellung: SOS Brutalismus. Rettet die Betonmonster! Ein gemeinsames Projekt des Deutschen Architekturmuseums und der Wüstenrot Stiftung. Schaumainkai 43, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069 21238844, www.dam-online.de
Bis 2. April 2018, anschließend vom 3. Mai bis 6. August 2018 im Architekturzentrum Wien
Katalog: SOS Brutalismus. Eine internationale Bestandsaufnahme. Hrsg. v. Oliver Elser, Philip Kurz, Peter Cachola Schmal. Deutsches Architekturmuseum, Wüstenrot Stiftung und Park Books AG, Zürich 2017, gebunden mit broschiertem Beiheft. ISBN 978-3-03860-074-9, 716 S., 68 Euro
Interview
Lesen Sie hier auch das Interview zum Thema mit Oliver Elser, Kurator der Ausstellung SOS Brutalismus im Deutschen Architekturmuseum.
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Die DenkmalAkademie der Deutschen Stiftung Denkmalschutz hält in diesem Halbjahr zwei Angebote zum Thema bereit.
Webinar: Schäden an Sichtbeton. 4.4.2018, 10–11 Uhr. Teilnahme kostenlos
Seminar: Baustilkunde Denkmale aus Beton (mit Schwerpunkt Brutalismus). 17.5.2018, 9–17 Uhr. Ort: Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Zentrale, Schlegelstraße 1, 53113 Bonn. Teilnahmegebühr 130 Euro.
Förderprojekte:
Lesen Sie über das Lehmbruckmuseum und die Liebfrauenkirche in Duisburg, über St. Agnes in Berlin und den Kirchenbau in den 1960er-Jahren.
Zwei der Rosen-Fenster aus dem Mariendom in Neviges sind Motive eines Postkarten-Sets, im Monumente Shop erhältlich.
Initiative
Eine Tagung zum Thema Brutalismus und Nachkriegsmoderne findet im Rahmen des Tags des offenen Denkmals und zum Kulturerbejahr am 6.9.2018 im Kölner Gürzenich statt. Veranstalter sind der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz und die Initiative Brutalismus im Rheinland.
Mit Hilfe von Crowdfunding – und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz – konnte das Buch „Architekturen des Gebrauchs – Die Moderne beider deutschen Staaten“, hrsg. von Dina Dorothea und Christopher Falbe, erscheinen. Ziel ist es, anhand ausgewählter Beispiele öffentlicher Bauten der 1960er- und 1970er-Jahre eine Neubewertung der Architektur der Nachkriegszeit und Perspektiven für ihre zukünftige Nutzung zu finden.
ISBN 978-3-944425-05-4, 232 S., 39 m. Bestellbar im Buchhandel oder unter www.m-books.eu
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Von Seekisten und Seeleuten 08.11.2012 Seekisten Was auf der hohen Kante lag

In den alten Zeiten der Frachtsegler musste die gesamte Habe des Seemanns in eine hölzerne Kiste passen. Manchmal liebevoll bemalt, war sie das einzige persönliche Stück, das ihn auf seinen Reisen über die Weltmeere begleitete.
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Mittelalterliche Wandmalereien in Behrenhoff 16.01.2018 Die Hölle Vorpommerns Die Hölle Vorpommerns

In der Dorfkirche von Behrenhoff haben sich eindrucksvolle Darstellungen des Fegefeuers erhalten.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz