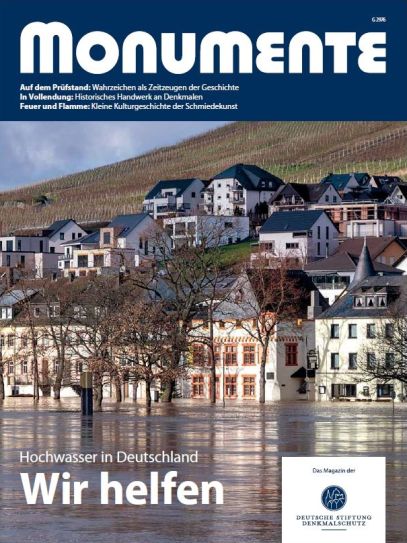Öffentliche Bauten Nach 1945 August 2017 S
Staatsbauten in Deutschland zwischen Monumentalität und Moderne
Von der Kultstätte zum Glashaus
Macht und Pracht, die Serie zum Tag des offenen Denkmals: Nachdem die Nationalsozialisten Architektur so wirkkräftig als Propaganda-Instrument eingesetzt hatten, scheute man bei den Staatsbauten der Demokratie lange Zeit die repräsentative Geste.
1937 wird Benito Mussolini zu seinem ersten offiziellen Besuch in Berlin erwartet. Die Ausschmückung dieses Ereignisses soll alle bisherigen Staatsfeierlichkeiten übertreffen: Das Propagandaministerium beauftragt den „Reichsbühnenbildner“ Benno von Arent damit, die Stadt in eine gigantische Festkulisse zu verwandeln. Temporäre Denkmäler, theatralisch angestrahlte Pylonen, Säulen und Fahnenmasten säumen den Weg des Autokorsos. Die Detailplanung besorgt der junge Architekt Fritz Bornemann.
Heute kennt man Bornemann als Vertreter der deutschen Nachkriegsmoderne, der etwa die Deutsche Oper in Berlin oder mit Pierre Vago die Bonner Universitätsbibliothek geschaffen hat. Auch Egon Eiermann, der mit seinen Werken der 1950er- und 1960er-Jahre so unzweifelhaft die demokratische Bundesrepublik repräsentierte, war im „Dritten Reich“ für Industriebauten gefragt. Dass solche Karrieren keine Ausnahme bilden, ist bekannt und der deutschen Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts eingeschrieben. Ihre Brüche und Kontinuitäten lassen sich vor allem an den Monumenten öffentlicher Repräsentation ablesen.
Die Inszenierung der Steine
Der erste Architekt, den Adolf Hitler für seine Münchner Partei- und später Staatsbauten auserkoren hatte, war Paul Ludwig Troost. Eine bekannte Größe – allerdings in Sachen Innenarchitektur: Als Ausstatter von Villen und Ozeandampfern der Luxusklasse war Troost in den 1920er-Jahren gut im Geschäft. 1931 erteilt Hitler dem Künstler, der für die Schaffung imposanter Szenarien prädestiniert zu sein scheint, den Auftrag, das Palais Barlow an der Brienner Straße zur Parteizentrale der NSDAP umzubauen. Mit „Fahnenhalle“ und „Standartensaal“, mit Hakenkreuz-Muster auf Zimmerdecken und Teppichen führt er den klassizistischen Adelssitz als „Braunes Haus“ in die neue Zeit. Hitler plant den Ausbau der Zentrale am Königsplatz, jenem vornehmen Ort monarchischer Kunstentfaltung.
Mit der „Machtergreifung“ schlägt auch Troosts große Stunde: Seine Münchner Werke werden zu Initiationsbauten nationalsozialistischer Repräsentations-Architektur. Der strenge, reduzierte Neoklassizismus der Fassaden ist geprägt von stereotyper Reihung. Charakteristische Stilmittel sind Rundbogenfenster in rechteckigem Rahmen und kannelierte Pfeiler, deren Kapitelle von schlichten, viereckigen Platten gebildet werden. Die Vorliebe für den rechten Winkel zeigt sich selbst im Schnitt der Profile und Gesimse. Der Bauschmuck wird auf wenige Hoheitszeichen reduziert, als Ornamente sind einzig das Hakenkreuz variierende Formen geduldet.
Am Königsplatz entstehen zwei nahezu identische natursteinverkleidete Gebäude: der „Führerbau“ und der „Verwaltungsbau“. Die zwei dazwischenliegenden „Ehrentempel“ korrespondieren mit Leo von Klenzes Propyläen auf der Westseite. In ihnen werden die Sarkophage der 16 „Märtyrer“ aufgestellt, die bei Hitlers gescheitertem Putsch am 9. November 1923 erschossen worden waren. Die Platzanlage wird mit 20.000 Granitplatten zur Aufmarschfläche umgewidmet.
Mit diesem Forum wird München wirkkräftig als „Hauptstadt der Bewegung“ legitimiert. Nicht nur der architektonische Formenkanon ist mit dem Ensemble vorbestimmt. NS-Architektur im öffentlichen Raum ist immer verknüpft mit Kult und Inszenierung. Zwei wesentliche Elemente dienen als emotionale Verstärker: pseudoreligiöses Totengedenken in unzähligen Ehrenhallen und theatralische Lichtspektakel bei Nacht – später von Albert Speer in seinen aus Flakscheinwerfer-Strahlen gebildeten „Lichtdomen“ zur Perfektion gebracht.
Dem zweiten Attribut „Hauptstadt der deutschen Kunst“ wird zeitgleich Rechnung getragen. Als Ersatz für den 1931 abgebrannten Glaspalast soll München ein neues Kunstausstellungsgebäude erhalten. Nach der Machtübernahme betraut Hitler Troost mit der Planung und bestimmt den Bauplatz am Südrand des Englischen Gartens. Bei der Grundsteinlegung für das „Haus der Deutschen Kunst“ im Oktober 1933 macht der neue Reichskanzler deutlich, dass Kunst und Politik für ihn nicht zu trennen sind: „Kein Wiederaufstieg ohne Wiedererweckung deutscher Kultur und Kunst“.
Der monumentale, breitgelagerte Bau mit den antikisierenden Säulenkolonnaden soll dem Volk seine Größe vor Augen führen. Die zeitgemäße Stahlkonstruktion wird mit Naturstein verbrämt, um diesem Tempel staatlich gelenkter Kunst die Ästhetik der Ewigkeit zu verleihen. Die Einweihung am 18. Juli 1937 begleitet ein Festzug, bei dem ein großes Architekturmodell wie ein liturgisches Schauobjekt durch die Straßen getragen wird. Wehrmacht und SS marschieren mit, um „2.000 Jahre deutsche Kultur“ zu feiern. Das menschenverachtende Prinzip der Erhöhung durch Unterdrückung bestimmt auch das Ausstellungsprogramm. Am Tag darauf eröffnet im Galeriegebäude am Hofgarten die Propagandaschau „Entartete Kunst“.
Auch in Berlin nimmt die künftige NS-Staatsarchitektur Formen an. Für den geplanten Erweiterungsbau der Reichsbank am Werderschen Markt wird im Februar 1933 ein Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich namhafte Vertreter der Moderne beteiligen. Hitler interveniert und verfügt, den Entwurf des Reichsbankbaudirektors Heinrich Wolff auszuführen. Dieser Vorgang kennzeichnet den Umbruch sehr viel deutlicher als die Architektursprache Wolffs, die einem sachlichen Monumentalstil folgt, wie er vom konservativen Lager schon in den 1920er-Jahren für vergleichbare Aufgaben angewendet worden war. Für den massigen, langgestreckten Baukörper muss ein gewachsenes Alt-Berliner Viertel auf dem Friedrichswerder weichen. Größe und monumentale Wirkung sollen keinen Zweifel daran lassen, wer im Stadtbild fortan das Sagen hat. Der neue Machthaber eignet sich das Bauprojekt an und schlachtet es propagandistisch aus. Die Grundsteinlegung am 5. Mai 1934 gerät zu einem Staatsakt mit 10.000 ausgewählten Zuschauern, der als „Weihehandlung“ inszeniert wird. Der Führerkult manifestiert sich von Beginn an in der Instrumentalisierung der Architektur.
Dabei ist die Antike eine wichtige Bezugsgröße. Man will sich an der Geschichte messen. Gerade im Vergleich mit den Hochkulturen des Altertums – allen voran das römische Weltreich – müssen die eigene Größe und das Streben nach Ewigkeit anschaulich werden. Demgemäß sehen sich die NS-Architekten als Vollender des Klassizismus an – weil erst sie die wahre klassische Form in die neue Zeit überführt hätten.
Zwar werden sämtliche neuen Bauaufgaben in den Dienst der Politik gestellt, dennoch gibt es keinen allumfassenden nationalsozialistischen Stil. Über die Form die rechte Stimmung zu erzeugen, ist ein wichtiges Kriterium. Für Hitlerjugendheime empfiehlt sich der ländliche Fachwerkstil im Sinne der Heimatschutzarchitektur, die NS-Ordensburgen orientieren sich an mittelalterlichen Anlagen. Im Industriebau sind sogar Anleihen an den Funktionalismus der eigentlich als bolschewistisch diffamierten Moderne erlaubt – unter Ausblendung aller gesellschaftlichen Gesichtspunkte, die die Avantgarde mit dieser Bauweise einmal verbunden hatte.

Für die staatlichen Renommierprojekte ist die stilistische Marschrichtung indes klar umrissen. Nach dem überraschenden Tod von Troost im Januar 1934 hat sich schnell ein Architekt gefunden, der Hitler und Goebbels bei der Errichtung des „Tausendjährigen Reiches“ zur Seite steht: Albert Speer beherrscht die Klaviatur des reduzierten Klassizismus und der kolossalen Form, mit der das totalitäre System seine Ideologie in Stein meißelt.
Mit dem Nürnberger Reichsparteitagsgelände nimmt die gebaute Propaganda am deutlichsten ihre gigantomanische Gestalt an. Die Stadt der kaiserlichen Reichstage galt völkischen Gruppierungen als wichtiger Traditionsort. Nach der Machtergreifung sollen die NSDAP-Parteitage zu einem Massenspektakel ausgeweitet werden. Dafür ist das als Naherholungsgebiet genutzte Dutzendteich-Areal auserkoren. 1934 fordert Hitler den Ausbau und überträgt den Gesamtplan seinem neuen Lieblingsarchitekten. Albert Speer konzipiert eine Anlage, die durch eine zentrale Achse gegliedert ist: Die Große Straße führt vom Märzfeld nach Norden und somit auf die Altstadt mit der Kaiserburg zu.
Wichtigster Schauplatz soll das Zeppelinfeld sein. Für die Haupttribüne mit Führerkanzel, eine riesige Treppenanlage mit Pfeilergalerie, nennt Speer den antiken Pergamonaltar als Vorbild. Das Märzfeld mit seinen Walltribünen und 24 Türmen soll Schaumanövern der Wehrmacht dienen. Das Deutsche Stadion mit einer Höhe von über 80 Metern und mehr als 400.000 Plätzen wird als die weltgrößte Arena verheißen. Hier sind „NS-Kampfspiele“ vorgesehen. Die 60 Meter hohe u-förmige Kongresshalle für 50.000 Menschen entwerfen Ludwig und Franz Ruff in Anlehnung an Theaterarchitekturen. Der Ziegelstein-Koloss soll mit Granitquadern verkleidet werden.
Die Parteitage werden bis 1938 auf der Großbaustelle abgehalten. Die mehrere Tage dauernden Veranstaltungen folgen einer ausgeklügelten Regie. Lage und Architektur des Geländes beschwören einen antiken Tempelbezirk herauf. In den diversen Zeremonien werden Elemente aus dem Herrscherkult und religiösen Ritualen verquickt. Höhepunkt ist jeweils der triumphale Einzug des „Imperators“. Das perfekt inszenierte Gemeinschaftserlebnis des Parteitags kann durch Leni Riefenstahls Propagandafilm „Triumph des Willens“ ab 1935 jeder auch im Kino nachvollziehen.
Nach Ausbruch des Krieges laufen die Bauarbeiten weiter – unter Einsatz von Kriegsgefangenen und mit Materialien aus KZ-Steinbrüchen. In weiten Teilen ausgeführt werden die Große Straße, die Luitpoldarena, das Zeppelinfeld und die Zeppelintribüne sowie das Märzfeld. Die Kongresshalle bleibt Torso, das Stadion eine gigantische Baugrube.
In Berlin hat Hitler derweil Albert Speer zum „Generalbauinspektor für die Neugestaltung der Reichshauptstadt“ ernannt und mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet. Nicht nur die Verwirklichung einzelner Monumentalbauten wie der Reichskanzlei, sondern vielmehr die Stadtplanung wird als immer wichtigeres Instrument bei der Mobilisierung und Manipulation der Massen mittels Architektur angesehen. Dabei stehen nicht allein die Reichshauptstadt und Nürnberg im Fokus. Ein grundlegender Umbau soll auch den „Führerstädten“ München, Hamburg und Linz zuteil werden. Darüber hinaus wird auf regionaler Ebene ein großangelegtes Bauprogramm ausgegeben, nach dem alle Gauhauptstädte Foren mit großer Halle und Aufmarschplatz erhalten sollen.
Selbstredend hat Berlin „als Hauptstadt eines starken neuen Reiches“ alles bisher Gekannte zu übertreffen. In Speers Planungen äußert sich der Anspruch auf die Weltherrschaft in megalomanen Projekten, markiert durch eine monumentale Achse. Zwar bestanden erste Pläne für die Nord-Süd-Achse durch ein Regierungsforum am Berliner Spreebogen schon im Kaiserreich und wurden in der Weimarer Republik weiterverfolgt – nun sind die Dimensionen allerdings ‚angepasst’. Die neue Achse soll auf die Große Halle zuführen, deren von der Weltkugel bekrönte Kuppel mit 290 Metern Durchmesser jedes menschliche Maß hinter sich lässt. Spätestens ab 1942 spricht Hitler von Berlin als künftiger „Welthauptstadt“, für die er den Namen „Germania“ auserkoren hat.
Erst recht während des Krieges soll die Überlegenheit und Siegesgewissheit des deutschen Volkes weiter auch via Baukunst transportiert werden. Dass der Technokrat Speer schließlich zum Rüstungsminister ernannt wird und die gesamte Kriegswirtschaft steuert, folgt der inneren Logik des Regimes und lässt ihn nicht nur als Entwerfer monumentaler Bauten, sondern als einen der Architekten des Holocaust in die Geschichte eingehen.

Schwieriger Neubeginn
Auch wenn nur ein Bruchteil der Pläne realisiert wurde, hat die Verquickung von Architektur und Ideologie im „Dritten Reich“ ein grausames Extrem erreicht – und fand doch in den nachfolgenden Systemen auf unterschiedliche Weise ihre Fortsetzung. In den beiden neugegründeten deutschen Staaten wurde der Kalte Krieg nicht zuletzt mit architektonischen Waffen ausgefochten.
Nach der Gründung der DDR im Oktober 1949 galt es zunächst, bei der Neugestaltung Berlins dem sow-jetischen Vorbild zu folgen. Mit einer nationalen Baukunst sozialistische Inhalte zu vermitteln, war das Gebot der Stunde, das sich auf dem Reißbrett in Plätzen für Massenkundgebungen, Magistralen und in Anleihen bei der klassizistischen Monumentalarchitektur niederschlug. Als klares Gegenmodell zur geschmähten westlichen Moderne wurde der Repräsentationsstil mit dem Bau der Stalinallee ab 1951 umgesetzt – den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen, hatte Priorität. Was die Regierungsbauten anging, widmete man ganz pragmatisch gut erhaltene NS-Hinterlassenschaften um, wie etwa die ehemalige Reichsbank für das Zentralkomitee der SED oder das Reichsluftfahrtministerium als „Haus der Ministerien“. Platz für Neues war immerhin symbolträchtig mit der Sprengung des Hohenzollernschlosses geschaffen worden.
Bereits Mitte der 1950er-Jahre war die Doktrin des stalinistischen Neohistorismus wieder obsolet. Der Wandel in der Kulturpolitik, der einherging mit der gleichfalls von Moskau vorgegebenen Industrialisierung des Bauens, ermöglichte nun die Hinwendung zur sachlichen Nachkriegsmoderne.
Neubauten für die DDR-Regierung entstanden erst nach dem Mauerbau. Den Anfang machte das Staatsratsgebäude als nüchterne Stahlskelettarchitektur mit Natursteinen, der mit dem Portal IV des Schlosses – vom Balkon hatte Liebknecht 1918 die sozialistische Republik ausgerufen – eine entscheidende Bezugsgröße eingearbeitet wurde.
Mit dem Palast der Republik ließ die Parteiführung 1973–76 ihren „Chefarchitekten“ Heinz Graffunder die Lücke im Zentrum schließen. Konzipiert als Sitz der Volkskammer sowie als Kultur- und Erlebnisstätte, war dieser Staatsbau ein „Haus des Volkes“, das der Öffentlichkeit nicht nur optisch viel Raum zusprach.
Im Westen Deutschlands hingegen wurde eilig die von den Nationalsozialisten verfemte Internationale Moderne rehabilitiert und zum einzig demokratischen Stil erklärt, zuweilen auch verklärt. Im Berliner Hansaviertel durften im Rahmen der „Interbau“ von 1957 namhafte Vertreter aus nah und fern zur großen Leistungsschau antreten – einerseits als Antwort auf die Stalinallee, andererseits um aller Welt den Neubeginn vor Augen zu führen.

Als Bonn 1949 zum provisorischen Parlaments- und Regierungssitz bestimmt wurde, standen Neubauten nicht zur Debatte. Für Bundesrat und Bundestag hatte man das 1930–33 in den Formen des Bauhauses errichtete Gebäude der Pädagogischen Akademie am Rheinufer auserkoren. Das Unspektakuläre war Programm: Sämtliche Maßnahmen, Bonn als Regierungssitz herzurichten, waren geprägt vom geradezu manischen Verzicht auf Herrschaftszeichen und Würdeformeln.
Die sachliche Schlichtheit der Akademie hat Hans Schwippert, der mit dem Umbau zum Bundeshaus betraut war, bereitwillig aufgegriffen und zu einer „Architektur der Begegnung“ umformuliert. Die wichtigste Zutat, der mit seinen beiden Glasfronten der Umgebung zugewandte Plenarsaal, wurde begeistert gefeiert als klares Signal für Offenheit und politische Erneuerung.
Bescheidenheit war gefragt – und mit diesem Attribut ist Staatsarchitektur im herkömmlichen Sinne kaum zu verwirklichen. Zudem entstanden alle Bonner Neubauten der 1960er-Jahre unter dem Damoklesschwert des Provisoriums und sollten im Zweifel leicht umzunutzen sein. Diese Vorgaben bestimmten letztlich auch Sep Rufs Kanzlerbungalow in seiner unauffälligen Eleganz und Egon Eiermanns Abgeordnetenhochhaus. Zwar prägte der „Lange Eugen“ nachhaltig das Stadtbild, allerdings als zweckmäßiges Bürogebäude durch seine schiere Höhe. Wenn sich die Beispiele auch in die erste Liga der Nachkriegsmoderne einreihen lassen, so blieben sie als Regierungsgebäude doch unspezifisch.
Das Dilemma aller frühen Bauprojekte: Man durfte sich weder nationaler Pathosgesten bedienen, noch allzu deutlich gegen eine mögliche Wiedervereinigung anbauen. Selbst den großen öffentlichen Platz ist man den Bonner Bürgern im zusammengeflickten Regierungsviertel aus Angst vor unrühmlichen Vergleichen schuldig geblieben.
Erst in den 1970er-Jahren wendete sich das Blatt, wurden Stimmen lauter, die die Abkehr vom Provisorium und ein selbstbewusstes Zeichen der Bonner Republik wünschten. 1986 wurde schließlich der Neubau des Plenarsaals beschlossen und in die Hände von Günter Behnisch gelegt, der mit dem Münchner Olympiastadion zumindest in architektonischer Hinsicht ein so positives Bild der freiheitlichen Bundesrepublik in die Welt gesendet hatte. Allerdings bedeutete dies den Abriss des denkmalgeschützten Schwippertschen Saals. Auch Behnisch konterkarierte den Habitus der Repräsentationsarchitektur mit viel Glas. Er entwarf eine unprätentiöse, leichte und verspielte Hülle um das kreisrunde Plenum und schuf ein Foyer, das sich Parallelität und Symmetrie mit jedem Detail demonstrativ verweigert. Man kann es unter Ironie der Geschichte verbuchen, dass das Gebäude fertiggestellt wurde, als das Land wiedervereinigt und der Regierungsumzug nach Berlin schon beschlossen war. Plötzlich markierte der Behnisch-Bau das Ende der Bonner Republik.

Abschied von der Bescheidenheit
Die junge Berliner Republik musste sich im Dickicht der Herrschaftszeichen, die Kaiserreich, Weimarer Republik, NS-Staat und DDR hinterlassen hatten, architektonisch gänzlich neu positionieren. So unmittelbar konfrontiert mit der widersprüchlichen Geschichte, flammte ein heftiger Streit darüber auf, welche Staatsarchitektur dieser Demokratie würdig und angemessen sei.
Beim Umbau des vielfältig konnotierten Reichstags bediente sich Norman Foster der vertrauten Symbolik und setzte auf die bewährte Ikonographie von Transparenz und Bürgerbeteiligung. Auf diese Weise hat er ein überkommenes Machtsymbol ins ausgehende 20. Jahrhundert und in eine selbstbewusste Republik hinübergerettet: Die begehbare, gläserne Kuppel funktioniert als Ausdruck des neuen Selbstverständnisses.
Der Palast der Republik hingegen, der Prestigebau der DDR schlechthin, wurde dem Müllhaufen der Geschichte überantwortet, um Platz für eine neue Mitte zu schaffen – die allerdings nicht mit zeitgenössischer Architektur besetzt wird. Dank reproduzierter Monumentalität soll das Berliner Schloss das „Stadtbild heilen“, wie die Initiatoren verkünden.

In Wahrheit gibt es keinen Stil, der demokratische Grundwerte abbildet oder gar ihre Einhaltung garantiert, was spätestens beim Blick auf andere Länder klar wird. Doch seit der SPD-Politiker Adolf Arndt 1960 in seiner vielbeachteten Rede von der „Demokratie als Bauherr“ gesprochen hatte, wurde dies von unzähligen Auftraggebern, Architekten und Kritikern auf die plakative Gleichung heruntergebrochen, wer seine Bauten mit dickem Naturstein verkleide, habe etwas zu verbergen. Dass man im Westen so lange vor entsprechenden Fassaden zurückschreckte, beweist, wie nachhaltig die von den Nationalsozialisten auf die Spitze getriebene Verquickung von Architektur und Politik tatsächlich wirkte.
Die Gestaltung der neuen Bauten des Bundes markiert die Überwindung des in der Nachkriegszeit ausgeprägten deutschen Leitbildes vom demokratischen Bauen. Dabei haben Bundespräsidialamt oder Kanzleramt vorgeführt, dass moderne Formensprache und repräsentativer Anspruch sehr wohl zu vereinen sind. Als symbolpolitische Projektionsfläche taugen sie nach wie vor. Bezeichnenderweise entzündete sich die Kritik am Bundeskanzleramt mit seinem Ehrenhof in der Öffentlichkeit gerade an der herausgehobenen Erscheinung im „Band des Bundes“. Nicht wenige werteten dies als autoritäre Geste. Es gehört eben auch zu den Errungenschaften der Demokratie, dass die Politik als Bauherr im Kreuzfeuer steht.
Bettina Vaupel
Literatur
Christian Welzbacher: Monumente der Macht. Eine politische
Architekturgeschichte Deutschlands 1920–1960. Parthas Verlag, Berlin
2016. ISBN 978-3-86964-106-5, 240 S., 29,90 €
Jörn Düwel, Niels
Gutschow: Baukunst und Nationalsozialismus. Demonstration von Macht in
Europa 1940–1943. Die Ausstellung Neue Deutsche Baukunst von Rudolf
Wolters. DOM Publishers, Berlin 2016. ISBN 978-3-86922-026-0, 480 S., 28
€
Service
Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände, Bayernstr. 110, 90478 Nürnberg, Tel. 0911 231-7538, geöffnet Mo–Fr 9–18, Sa, So 10–19 Uhr.
Ausstellung „Albert Speer in der Bundesrepublik. Vom Umgang mit deutscher Vergangenheit“, bis 26.11.17
Besucherzentrum im Olympiapark.
Am Glockenturm, 14053 Berlin, Tel. 030 3058123, geöffnet 1.4.–31.10. tägl. 9–18 Uhr.
Die Dokumentationsausstellung berücksichtigt auch den Langemarckmythos.
Macht und Pracht
heißt das Motto des Tags des offenen Denkmals 2017. Gezeigt werden soll, wie Adel, Bürgertum, Kirche und Politik durch Architektur und Kunst(handwerk) ihren Führungsanspruch sichtbar machten. Beleuchtet werden in diesem Zusammenhang auch auch die Staatsbauten des Nationalsozialismus, der ehemaligen DDR und der jungen Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland bis hin zu heutigen Repräsentationsbauten.www.tag-des-offenen-denkmals.de

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Von Seekisten und Seeleuten 08.11.2012 Seekisten Was auf der hohen Kante lag

In den alten Zeiten der Frachtsegler musste die gesamte Habe des Seemanns in eine hölzerne Kiste passen. Manchmal liebevoll bemalt, war sie das einzige persönliche Stück, das ihn auf seinen Reisen über die Weltmeere begleitete.
-
Mittelalterliche Wandmalereien in Behrenhoff 16.01.2018 Die Hölle Vorpommerns Die Hölle Vorpommerns

In der Dorfkirche von Behrenhoff haben sich eindrucksvolle Darstellungen des Fegefeuers erhalten.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
Lesen Sie 1 Kommentar anderer Leser
-
 Eckhard Mohr schrieb am 02.09.2017 16:36 Uhr
Eckhard Mohr schrieb am 02.09.2017 16:36 UhrZum Portal IV des Berliner Stadtschlosses:
Auf diesen Kommentar antworten
Es soll nicht belegt sein, dass Liebknecht von diesem Balkon aus gesprochen hat. Unklar ist, ob es überhaupt das Portal IV war und nicht ein anderes vor dem er gesprochen hat. Es gibt auch die Meinung, dass er wohl eher von einem Lastwagen herab vor dem Schloss gesprochen hat, weil er vom Balkon aus wohl kaum hörbar gewesen wäre.
Das Portal, das in das Staatsratsgebäude eingefügt wurde, ist nicht im Orighinalzustand, sondern wurde zurecht gestutzt, damit es passte und unliebsame Symbole (Adler) wurden entfernt.
Mit dem Palast der Republik wurde nicht "die Lücke im Zentrum" geschlossen, sondern es blieb eine große freie Fläche des Aufmarsch-Platzes übrig. Um die Lücke im Zentrum zu schließen, hat daher ja auch in den 1990ger Jahren ein Stadtplanungswettbewerb statt gefunden.
Zur "Monumentalität" des Stadtschlosses:
Was wirkt eigentlich monumentaler - die moderne Ostfassade oder die barocke Lustgartenfassade?
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz