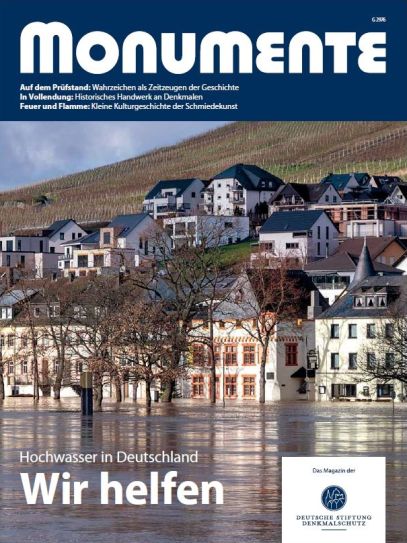Wohnhäuser und Siedlungen Historismus April 2017 U
Die Villen der Industriellen im Ruhrgebiet
Unser Reichtum gestattet es
Macht und Pracht, die Serie zum Tag des offenen Denkmals: Komfortables Wohnen und Repräsentieren – diese Komponenten musste die Unternehmervilla spätestens im wilhelminischen Kaiserreich ermöglichen.
Ein fachwerkverzierter Erker hier, ein maurischer Bogen dort, ein giebelbekrönter Risalit vorne und eine italienische Loggia hinten. Kurz: ein Ausweis an Geschmacksverirrung. So stellte man sich gern das protzige Wohnhaus einer Industriellenfamilie vor. Die Gebäude, die sich die erfolgreichen Unternehmer seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichten ließen, gaben immer wieder Anlass zur Häme – unter zeitgenössischen wie nachfolgenden Architekturtheoretikern. Die ‚neureichen‘ Fabrikanten galten als besonders empfänglich für die übertriebene Zurschaustellung ihres Wohlstands mittels Fassade.
Solche Diskurse verweisen einerseits auf den schlechten Ruf, der dem Historismus mit seinem Hang zum unbefangenen Eklektizismus lange Zeit anhing, gründen andererseits auf einer alten Rivalität. Im Zeitalter der großen sozialen Aufstiege konkurrierten die Vertreter des Adels, des bereits etablierten Bildungs- und des neuen Wirtschaftsbürgertums um die gesellschaftlichen Machtverhältnisse. In der Phase der Hochindustrialisierung nach der Reichsgründung waren es vor allem letztere, die ihre Selbstdarstellung mit aufwendigen Neubauten untermauerten.
Beispielhaft lässt sich dies im Ruhrgebiet nachvollziehen: Das rheinisch-westfälische Bergbau-Revier war durch den frühen Einsatz von Dampfmaschinen, den Ausbau des Schienennetzes und die Eisen- und Stahlproduktion im großen Stil zur wichtigsten Industrieregion überhaupt avanciert. Diese Entwicklung hatte vielen Fabrikantenfamilien zu einem rasanten Emporkommen verholfen, ihnen Finanzkraft und Einfluss verschafft. Im privaten Wohnhausbau nahmen sie nun eine wichtige Rolle unter den Bauherren ein.

Arbeiten und Wohnen rücken auseinander
Ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum typischen
Unternehmerwohnsitz war zunächst die klare Trennung von Produktions- und
Wohnstätte. Für die Frühphase der Industrialisierung an der Ruhr steht
wie kein zweiter der Name Harkort. Friedrich Wilhelm Harkort hatte 1819
auf der Burg Wetter eine der ersten Maschinenfabriken in Deutschland
gegründet. Seine vielfältigen Bemühungen um den technischen Fortschritt
brachten ihm später den Ehrentitel „Vater des Ruhrgebiets“ ein. Geboren
wurde er 1793 in dem nahe Hagen gelegenen Haus Harkorten. Über
Jahrhunderte diente das landwirtschaftliche Gut in der Grafschaft Mark
der Familie als Stammsitz. Schon im späten 17. Jahrhundert hatte sie
ausgedehnten Handel mit Eisenwaren betrieben und im 18. Jahrhundert
mehrere Hammerwerke unterhalten. Diverse Neubauten auf Harkorten zeugten
vom stetig wachsenden Wohlstand der Kaufmannsfamilie.
1756 leistete man sich ein repräsentatives Wohnhaus im Stil des
Bergischen Barock, das im Bürgerhausbau ein Zeichen setzte: Die
Mittelachse wurde durch ein zweigeschossiges Zwerchhaus mit
geschwungenem Giebel und Pilasterrahmung sowie durch ein prächtig
geschmücktes Eingangsportal mit Freitreppe betont. Zusammen mit den
älteren Nebengebäuden unterstrich eine lindengesäumte Zufahrt die axiale
Ausrichtung der Anlage – all dies waren Elemente, die man vom
Schlossbau kannte.
Entscheidend aber war, dass mit dem neuen
Haupthaus erstmals ein deutlicher Bruch vollzogen wurde: Ungewöhnlich
für einen nicht-adeligen Bauherren im ländlichen Bereich war der
Verzicht auf Räume, die mit der Landwirtschaft oder der Produktion in
direkter Verbindung stehen. So dokumentiert das ganz auf Repräsentation
ausgerichtete Haus Harkorten die gesellschaftliche Stellung, die die
Unternehmerfamilie bereits zu jener Zeit einnahm.

Während Betrieb und Familie in der vorindustriellen Phase in vielerlei Hinsicht noch eine feste Einheit verkörperten, wurde diese mit fortschreitender Industrialisierung immer weiter aufgebrochen – auch räumlich. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts lebten die Unternehmer in den Städten oftmals in schlichten Wohnhäusern auf dem Werksgelände.
In der Folge verlagerte man Arbeitsstätte und Wohnung ganz bewusst in getrennte Sphären. Es waren nicht nur die rauchenden Schlote, die die Fabrikbesitzer an den Stadtrand und ins Grüne ziehen ließen. Mit steigender Wirtschaftskraft und gesellschaftlichem Ansehen galt die Villa als der angemessene Wohnsitz, der Repräsentation und Rückzug gleichermaßen ermöglichte. Die Trennung von Arbeits- und Privatleben war eine Errungenschaft, die das Bürgertum für sich reklamierte.
Ab der Jahrhundertmitte bauten sich Unternehmer Villen, wie man sie von den Landsitzen des Adels kannte. Das aufwendig gestaltete Haus, freistehend in meist herausgehobener Lage, umgeben von einem Garten oder Park, wurde jetzt zum Bautyp des Großbürgers, sollte ein Ausdruck für Status und Persönlichkeit des Bauherren sein. Die ausführenden Privatarchitekten schöpften für die neue Bauaufgabe aus einem vielfältigen Fundus, machten Anleihen bei herrschaftlichen Bauten der Renaissance oder des Klassizismus. Vor allem barockisierende Formen waren trefflich umzumünzen auf die gediegene bürgerliche Villa.

Die Raumaufteilung im Inneren folgte einem klassischen Schema: In der Regel befanden sich im Erdgeschoss die Gesellschaftsräume, darunter ein großer Speisesaal. Sie waren vom familiären Wohnbereich klar geschieden. Gleichfalls separiert wurden die Personal- und Wirtschaftsräume, in größeren Häusern sogar in einem eigenen Trakt samt Dienstbotentreppe.
Der Trennung von öffentlicher und privater Sphäre diente auch das Herrenzimmer: Hierhin konnte sich der Hausherr zu wichtigen Gesprächen mit seinen leitenden Angestellten zurückziehen und geschäftliche Kontakte pflegen. Die großzügige Halle, oft mit mehrläufiger Treppe, diente als repräsentatives Entree. Sie wurde nicht selten mit Wandvertäfelungen, Marmorinkrustationen und Stukkaturen aufgewertet.
Unverzichtbar waren der Wintergarten, ein Musik- oder Billardzimmer, Gästezimmer und moderne Bäder. Im Idealfall war die Villa des Großindustriellen der Ort, von dem aus er die Fäden des Unternehmens zog und wo zugleich das bürgerliche Familienideal gelebt wurde: repräsentativ, funktional und wohnlich.
Es gab Möbel- und Einrichtungsfirmen, die sich auf gehobene Innenausstattungen spezialisiert hatten und ganze Raumfassungen von „Tiroler Gotik“ über „Danziger Renaissance“ bis hin zu „Louis XVI“ anboten. Viele großbürgerliche Villen spiegelten die für den Späthistorismus charakteristische Gepflogenheit wider, für jeden Raum einen eigenen Stil zu wählen. In den Herrenzimmern fand sich häufig Renaissance, die Damen umgaben sich gerne mit Empire oder Biedermeier.

Während die Möblierung meist konventionell ausfiel, legten die Bauherren größten Wert darauf, dass ihr Domizil auf dem neuesten Stand in Sachen Heiztechnik, Strom- und Wasserversorgung war. An die Küchen waren Kühlräume angeschlossen, Staubsaugeranlagen gehörten in vielen Villen zum Standard. Größtmöglicher Komfort und reibungsloser Ablauf sollten gewährleistet sein. Behaglichkeit war im 19. Jahrhundert das Schlüsselwort für die bürgerliche Wohnkultur.
Bei allen verhaltenen Anklängen an feudale Architektur, war es das Bekenntnis zum Fortschritt, das die Unternehmerwohnsitze ausmachte. Auch wenn die Finessen nicht unmittelbar in Erscheinung traten, waren sich die Industriellen doch gewiss, sie selbst vorangebracht zu haben. Hier lag der wahre Luxus, mit dem die Noblesse in ihren zugigen Schlössern überboten werden konnte. Die Industriebürger an der Ruhr waren sich ihrer bürgerlichen Werte sehr bewusst und emanzipiert genug, den Adel nicht nachahmen zu wollen. Im Gegenteil: Man hob darauf ab, dass man sich den Wohlstand und die Privilegien durch Leistung selbst erarbeitet hatte.
Die Wohnmaschine auf dem Hügel
Dieses Standesbewusstsein und ein unerschütterlicher Glaube an die
Technik waren bei einem Ruhr-Industriellen ganz besonders ausgeprägt:
Alfred Krupp (1812–87). Und so sollte seine Villa alles, was der
bürgerliche Wohnbau bis dahin gekannt hatte, in den Schatten stellen. Er
hatte aus der nicht gerade lukrativen Essener Gussstahlfabrik seines
Vaters nach der Jahrhundertmitte ein bedeutendes Großunternehmen
gemacht.

Zunächst wohnt die Familie noch in unmittelbarer Nachbarschaft der Fabrik, wo der 1861 in Betrieb genommene Wunder-Dampfhammer „Fritz“ mit seinem Fallgewicht von 50 Tonnen für ständigen Lärm und Erschütterung sorgt. Ein Umzug ist unumgänglich. 1864 erwirbt Alfred Krupp den Klosterbuschhof auf den Bredeneyer Höhen über der Ruhr und lässt ihn zu einem Landsitz umbauen.
Doch Krupp denkt weiter, hat auch die nachfolgenden Generationen und das expandierende Unternehmen im Blick. Er kauft Gelände hinzu und wünscht sich „ein großes industrielles Etablissement“ mit Gartenanlagen, Stallungen, einer Reitbahn, Fischteichen und Wildpark als „Mittel der Lebensverlängerung“. 1869 wird in der Deutschen Bauzeitung ein tüchtiger Architekt „für die Ausarbeitung der Entwürfe zu einer großen Villa“ gesucht. Besagte Entwürfe liefert er selbst. Warum sollte ein genialer Erfinder kein Haus zustande bringen? Für einen wie ihn, der es als Wohnmaschine begreift, erscheint dies nur konsequent. Krupp sprengt alle Dimensionen – nicht nur durch die schiere Größe der projektierten Villa, sondern auch durch seine ständige Einflussnahme und die Änderungswünsche, die eine ganze Schar von Architekten an den Rand des Wahnsinns und der Berufsehre bringen. Proportionen und harmonische Gestaltung interessieren ihn nicht.
Im April 1870 findet die Grundsteinlegung statt. Rund 800 Arbeiter sind auf der Baustelle beschäftigt. Der Bauherr ist der absolute Souverän bei dieser Maßnahme und zeigt sich auch in diesem einen Punkt unerbittlich: Die für ihn arbeitenden Architekten dürfen keinesfalls von Adel sein. Zwar hat er, was den Baukörper angeht, Anleihen bei Schlössern und Herrenhäusern gemacht, doch hält er künstlerischen Fassadenschmuck für überflüssig.

Der Komplex besteht aus dem dreigeschossigen, von einem sogenannten Belvedere bekrönten Wohnhaus, das durch einen Wintergarten mit dem ebenfalls dreigeschossigen Logierhaus verbunden ist. Das Äußere verweist auf eine nüchterne Version spätklassizistischer Villenarchitektur. Als Tragsystem dient eine Eisenkonstruktion, die ingenieurstechnisch auf dem allerneuesten Stand ist.
Das Innere des Haupthauses wird im Erdgeschoss und im Obergeschoss jeweils durch die zentrale, über 400 Quadratmeter große Halle bestimmt. Die nicht für die Gesellschaft bestimmten Räume im ersten Stock fallen hingegen recht bescheiden aus und sollen auch so möbliert werden.
Technisch muss alles perfekt werden: Das Haus soll feuersicher sein, Schutz vor Sonne, Wind, Kälte und Hitze bieten, mit Doppelfenstern, Jalousien, Wasserheizung und Ventilation ausgestattet sein. Die Temperatur will Alfred Krupp in jedem Zimmer separat regulieren können. Vor allem aber soll die komplizierte Belüftungsanlage für reine und gesunde Luft sorgen – hier spielen aktuelle Hygienefragen eine wichtige Rolle. Im Umfeld entsteht ein großer Ökonomiebereich, ja sogar ein eigenes Wasser- und Gaswerk.

Krupp drängt zur Eile, obwohl der Deutsch-Französische Krieg den Baubetrieb erschwert und Bergschäden einen Teil des Mauerwerks absacken lassen. Doch am 10. Januar 1873 ist es tatsächlich so weit: Familie Krupp bezieht die Villa Hügel. Dass der „Kolossalkasten“ die Architekturkritiker nicht überzeugen kann, dürfte den Hausherren nicht angefochten haben. Allerdings läuft die experimentelle Haustechnik nicht wie gewünscht: Es zieht in den Räumen, und nach Tisch hängt der Küchendunst in der Halle. Wieder gibt er den Architekten die Schuld an dem Desaster. Es muss nachgebessert werden.
Immerhin: Als Repräsentationsort der Firma Krupp funktioniert die Villa Hügel. Die ‚Hofhaltung‘ mit der Armada von Dienstpersonal ist minutiös durchorganisiert – nämlich wie ein Großbetrieb mit bürgerlicher Disziplin. Auch wenn Alfred Krupp sich ganz bewusst vom Adel distanziert, die vom preußischen König Wilhelm I. avisierte Nobilitierung ablehnt, hat er mit diesem Unternehmer-Anwesen das Zeichen gesetzt, den allerhöchsten Herrschaften auf Augenhöhe begegnen zu können. Könige und Kaiser aus aller Welt lassen sich hier empfangen.
1887 stirbt der „Kanonenkönig“ an Herzversagen, die nachfolgenden Familienoberhäupter bauen die Macht weiter aus. Als wichtigster Produzent für Eisenbahn und Militär rangiert der Industriekonzern im wilhelminischen Zeitalter fast als Staatsunternehmen. Unter Friedrich Alfred und Margarethe Krupp wird die Villa dem noch gesteigerten Repräsentationsbedürfnis und dem persönlichen Geschmack angepasst und im Inneren üppig umgestaltet. Kaiser Wilhelm II. gibt sich neun Mal die Ehre auf dem Hügel.
Das heutige Erscheinungsbild geht auf die Enkelgeneration zurück: Bertha und Gustav Krupp von Bohlen und Halbach veranlassten ab 1912 größere Umbauten durch den Hofarchitekten Ernst von Ihne, das luxuriöse, holzlastige Interieur und die Ausstattung mit Kunstschätzen.

Luxus durch Leistung
Das gigantische Privathaus mit seinen 269 Zimmern lässt alle anderen Villen zwangsläufig verblassen. Dabei haben in der Hochphase der industriellen Entwicklung unzählige Unternehmer ihrer Prosperität mit prächtigen Wohnsitzen Ausdruck verliehen.
Die Familie Thyssen, die Ruhr-Industriellen-Dynastie, die in ihrem spektakulären Aufstieg den Krupps noch am nächsten kam, hat diesem mit sehr unterschiedlichen Domizilen Rechnung getragen. Aus der von August Thyssen 1871 in Styrum bei Mülheim gegründeten Stammfirma wurde innerhalb weniger Jahrzehnte einer der größten Stahlkonzerne des Reiches. Man hatte sich „mit den kleinsten Mitteln“ und durch Fleiß emporgearbeitet.
Joseph Thyssen war 1877 in das Unternehmen des älteren Bruders eingetreten und hatte einige Jahre später standesgemäß eine Frau aus der angesehenen Unternehmerfamilie Bagel geheiratet. 1898–1900 ließ sich das Ehepaar, das bis dahin mit seinen Kindern in Mülheim in einer großzügigen Werkswohnung lebte, eine repräsentative Villa errichten. Das Grundstück an der Dohne 54 bot eine herausgehobene Stadtrandlage am Ruhrhang. Mit dem Entwurf wurden Kayser & von Großheim aus Berlin betraut, die zu den renommiertesten Architekturbüros im Kaiserreich zählten, eine Zweigstelle in Düsseldorf unterhielten und sich neben diversen Großbauten vor allem mit Villen im wilhelminischen Neobarock hervortaten.

Das zweigeschossige Gebäude wird von einem Walmdach mit Belvedere bekrönt. Die Fassaden aus Sandstein sind mit Risaliten akzentuiert und mit plastischem Bauschmuck üppig verziert. Barocke und klassizistische Elemente, die auf feudale Architektur verweisen, sind zu einem würdevollen Ganzen kombiniert. Die Repräsentationsräume im Erdgeschoss wurden wie üblich um die zentrale Halle gruppiert, die mit Säulen aus rotem Marmor, einer kunstvollen Stuckdecke und halbhoher Wandvertäfelung herrschaftlich daherkam. An den Speisesaal und das Musikzimmer schloss sich der Wintergarten an, der mit Wandmalereien im pompejanischen Stil geschmückt war. Zwar übertraf Joseph Thyssens Villa in der Fassadengestaltung, in der Ausstattung der Innenräume sowie mit ihrem riesigen Park die anderen Mülheimer Industriellenwohnsitze, entsprach aber letztlich dem gängigen, soliden Schema.
Einen weit ausgefalleneren Wohnsitz erlaubte sich der Firmengründer August Thyssen. Inzwischen von seiner gleichfalls der Mülheimer Oberschicht entstammenden Gattin geschieden, erwarb er 1903 das bei Kettwig gelegene Schloss Landsberg. Er ließ die in ihren Ursprüngen mittelalterliche Höhenburg der Herren von Landsberg für seine Zwecke um- und ausbauen und den Garten neu gestalten. Hier hatte sich ein Wirtschaftsbürger einen echten Adelssitz angeeignet und dies auch sehr bewusst inszeniert. Für die Gesellschaftsräume wählte August Thyssen aufwendige Interieurs in den beliebten gründerzeitlichen Stilrichtungen von Renaissance über Barock bis Louis Seize. Doch auch der Jugendstil hielt Einzug ins Schloss: Der Clou des Hauses war das Luxusbadezimmer, das die Firma Voltz & Wittmer 1900 auf der Pariser Weltausstellung präsentiert hatte und das nun auf Landsberg installiert wurde. Jahrhundertealte feudale Tradition wurde auf dem Thyssenschen Anwesen mit zeitgemäßem Wohnstandard kombiniert.

Dass die Villa um 1900 mehr denn je unverzichtbares Statussymbol der Wirtschaftselite war, lässt sich in Mülheim an der Ruhr bis heute gut nachvollziehen. In der wichtigen Industriestadt entstanden ganze Straßenzüge und Viertel mit vornehmen Häusern.
Der Architekt Franz Hagen war auf diesem Gebiet besonders rege. 1913
errichtete er für den Lederfabrikanten Jean Baptiste Coupienne am
Kahlenberg das Haus Urge, einen zweigeschossigen Bau mit
Natursteinfassade und Mansardwalmdach. Die Eingangsseite betont ein
Portalvorbau mit ionischen Säulen. Die Ehefrau hatte sich Anklänge an
ihr Elternhaus, das barocke Herrenhaus Blegge im Bergischen Land,
gewünscht, die Hagen unter anderem mit den Ecktürmen umsetzte, die hier
den Wintergarten auf der Gartenseite flankieren. Die Villa vermittelt
eine eher strenge Monumentalität, ihre Fassaden sind von schlichter
Eleganz geprägt – was den Mülheimer Volksmund nicht davon abhielt, die
Bezeichnung Haus Urge als Abkürzung für „Unser Reichtum gestattet es“ zu
lesen.
Im Inneren herrschte größtenteils die typische Raumfolge und Ausgestaltung vor. Allerdings war die Küche im Erdgeschoss untergebracht, nur durch Spülküche und Anrichte vom Esszimmer getrennt. In den Villen des 19. Jahrhunderts lagen die Wirtschaftsbereiche grundsätzlich im Souterrain. Hagen nahm mit Haus Urge aktuelle Reformbestrebungen zu mehr Sachlichkeit und Funktionalität im Wohnbau auf. Hermann Muthesius etwa, der den Weg zum modernen Landhaus nach englischem Vorbild aufzeigte, empfahl unter anderem die möglichst bequeme Verbindung der Küche zu den Wohnräumen.
Der Bauaufgabe Unternehmervilla setzten der Erste Weltkrieg und sich verändernde Strukturen ein Ende. Einen wirklich prägnanten Typ hat sie, abgesehen von den Raumstrukturen, nicht hervorgebracht. Während das Gros in der eigentümlichen Balance zwischen historischer Form und zeitgemäßer Umsetzung verharrte, entwarfen Architekten wie Peter Behrens oder Henry van de Velde kunstsinnigen Auftraggebern Wohnhäuser, die weit in die Moderne wiesen.
Oft von den Familien noch einige Jahrzehnte privat genutzt und von Kriegsschäden und Abrisswut verschont, sind die meisten Beispiele glücklicherweise bis in unsere Zeit erhalten. Als Baudenkmale machen sie ebenso wie die unzähligen Arbeitersiedlungen einen wichtigen Teil der Industriegeschichte des Ruhrgebietes aus.
Manche sind öffentlich genutzt, aus anderen wurden Mehrparteienhäuser. In gut erhaltenem Zustand mit weitgehend ursprünglicher Aufteilung werden die prächtigen Domizile bezeichnenderweise heute gerne als Firmensitze genutzt. Längst stehen die Fassaden für Tradition und Kultur. Die Architektursprache funktioniert nach über hundert Jahren besser denn je und vermittelt das alte Bürgerethos, durch gute Arbeit gut dazustehen.
Bettina Vaupel
Villa Hügel
Hügel 15, 45133 Essen, Tel. 0201 616290, geöffnet Di–So 10–18 Uhr, Öffentliche Führungen So 11 + 14 Uhr.
Hügel-Park tägl. 8–20 Uhr. www.villahuegel.de
Sonderausstellung
25.3. bis 8.10.2017: „Humboldt dankt, Adenauer dementiert. Briefe aus dem Historischen Archiv Krupp“
Schloss Landsberg
August-Thyssen-Str. 1, 45219 Essen-Kettwig. Der Park
ist öffentlich zugänglich. Das Schloss kann nur mit einer angemeldeten
Führung besichtigt werden. Tel. 02054 929-0 o. 0201 844538012
Route der Industriekultur
Die Seite des Regionalverbands Ruhr verzeichnet unter der Themenroute Nr. 20 „Unternehmervillen“.
Die Erläuterungen sind auch als Broschüre erhältlich (5 €), Tel. 0201 2069-206
www.route-industriekultur.ruhr.de
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther 04.07.2017 Ulrich Müther Hyparschalen

Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
-
Mittelalterliche Wandmalereien in Behrenhoff 16.01.2018 Die Hölle Vorpommerns Die Hölle Vorpommerns

In der Dorfkirche von Behrenhoff haben sich eindrucksvolle Darstellungen des Fegefeuers erhalten.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
Lesen Sie 1 Kommentar anderer Leser
-
 Manfred schrieb am 15.12.2020 12:27 Uhr
Manfred schrieb am 15.12.2020 12:27 UhrInteressant, dass Arbeiten und Wohnen früher nicht so strikt getrennt waren. Wir möchten bei Hanau bauen. Uns gefallen diese alten Villen ganz gut. So groß ist unser Budget jedoch nicht. Mit verschiedenen Baumaterialien kann man jedoch auch historische Effekte erzeugen. Neubauten gefallen wir oft nicht.
Auf diesen Kommentar antworten
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz