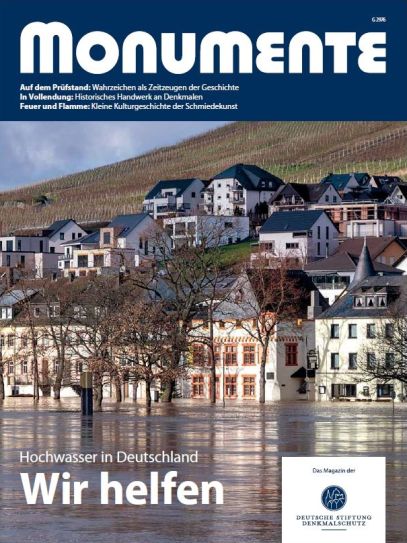Sehen und Erkennen Ikonographie August 2014 K
Was ist eine Knagge?
Sehen und Erkennen
In der Baukunst ist die Knagge ein Kantholz. Sie dient als Konstruktionselement, das die Balken verriegelt und den Überhang eines Stockwerks in der Art einer Konsole gegen die Wand abstützt.
Beim historischen Fachwerk mit auskragenden oberen Stockwerken werden Knaggen zum Aussteifen und Abtragen von Lasten zwischen den Ständern und den hervorstehenden Deckenbalken eingebaut. Im Gegensatz zum Kopfband oder zum Bug sitzt die Knagge nicht im Gefach - das ist im Fachwerkbau der Raum zwischen den Holzbalken -, sondern ragt aus dem Wandgefüge heraus.
Trotz der erheblichen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg haben sich in Deutschland über eine Million Fachwerkbauten erhalten.Eigentlich sind nur die südlichen Teile Bayerns weitgehend "fachwerkfrei". Die künstlerische Ausgestaltung von Fachwerkhäusern ist je nach Region und Erbauungszeit unterschiedlich stark ausgeprägt.
Auf Knaggen finden sich die frühesten figürlichen Darstellungen im Fachwerkbau überhaupt. Durch ihre exponierte Lage laden sie zu Verzierungen ein. In Wernigerode an der Ratswaage kommen sie schon um 1450 vor. Hauptsächlich sind sie in der Gegend um Braunschweig, Hildesheim bis hin nach Göttingen, Einbeck, ¬Alfeld und westlich nach Osnabrück verbreitet. Die Motive stammen in der Regel aus der christlichen Glaubenswelt, der antiken Mythologie, dem Bereich der Sagen, sind oft Allegorien oder scherzhafte Figuren. Im niederdeutschen Raum gibt es häufig Knaggen mit scharfkantigen Wülsten und Kerben, die der Gotik zugeschrieben werden. Statt menschlicher Figuren treten auch florale Gestaltungen bei Knaggen sehr früh auf.
Das Stiftsherrenhaus in der Osterstraße 8 in Hameln kann sich mit besonders schönen Knaggen und Dreierknaggen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts schmücken. Sie zeigen Szenen aus dem Alten Testament. In der Brüderstraße 26 in Herford steht das 1521 erbaute sogenannte Remensnider-Haus. Es gilt als das künstlerisch reichste spätgotische Fachwerkhaus Westfalens. Seine Figurenknaggen zeigen die christliche Hierarchie von Jesus als Weltenrichter bis zum Höllentor. In der Brüderstraße 15 entstand um 1560 das Rothe-Haus, einer der ältesten Profanbauten der Stadt, dessen Restaurierung die Deutsche Stiftung Denkmalschutz förderte. Das Obergeschoss kragt auf beschnitzten, von Knaggen unterstützten Balkenköpfen aus. Das Eickesche Haus an der Marktstraße 13 in Einbeck, errichtet 1612, ist ein wichtiges Zeugnis aus der Blütezeit der Weserrenaissance. Seine Sanierung wurde mit einer namhaften Summe durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mitfinanziert. Die reich ornamentierten Knaggen werden von Balkenköpfen bekrönt, die verschiedenste Masken zieren.
Dadurch, dass Zimmerleute und Bildhauer die Knaggen so künstlerisch gestaltet haben, ist dieses verhältnismäßig kleine konstruktive Element zu einem bemerkenswerten Schmuck geworden.
Christiane Schillig
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Otto Bartning und seine Kirchen 09.03.2016 Bartning Kirchen Spiritualität in Serie

Otto Bartning gehört zu den bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Wegweisend sind seine Raumschöpfungen im Bereich des protestantischen Kirchenbaus.
-
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther 04.07.2017 Ulrich Müther Hyparschalen

Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
-
Die neue Lust am Bungalow 08.11.2012 Bungalows Die Leichtigkeit des Steins

Fast 17 Millionen Dollar. Das ist auch für das Auktionshaus Christie's keine alltägliche Summe. Bei 16,8 Millionen Dollar ist im Mai bei einer Auktion in New York für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst der Zuschlag erfolgt, und zwar für - und das ist ebenso ungewöhnlich - ein Bauwerk. Nicht einmal ein besonders großes.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
Lesen Sie 0 Kommentare anderer Leser
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz