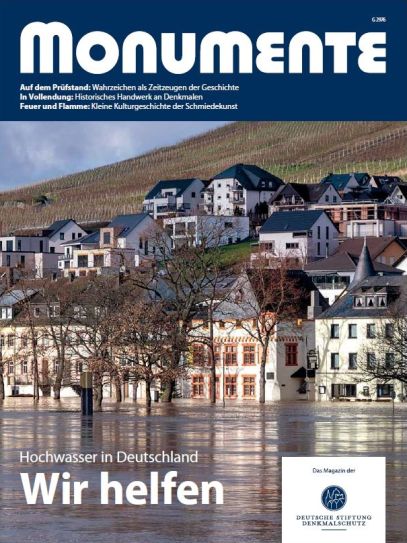Wohnhäuser und Siedlungen Menschen für Denkmale Februar 2014 W
Genossenschaften restaurieren im großen Stil
Schöner Wohnen
Denkmalpflege ist in der Regel Maßarbeit, jeder Baukörper ein Individuum mit besonderen Ansprüchen. Bei Wohnsiedlungen, die unter Denkmalschutz stehen, geht es hingegen ums Restaurieren im großen Stil, oft um ganze Stadtquartiere inklusive ihrer Wege und Grünflächen. Mit einer solchen Konfektionsarbeit, so möchte man glauben, lässt sich sehr schnell sehr viel erreichen.

Aber das hat seine Tücken. Viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Interessen - darunter Bauherren, Wohnungsbaugesellschaften, Architekten, Klimatechniker und Denkmalpfleger - wetteifern miteinander. Daher gehören sie an einen Tisch, sollten ein gemeinsames Ziel verfolgen: das Bild unserer Städte verschönern, den Wohnkomfort verbessern und Kulturgut schützen. Zudem gilt es, Ressourcen zu schonen und Energie zu sparen. Es ist eine große Herausforderung unserer Zeit, Wohnsiedlungen zu sanieren - weit über Fragen der Denkmalpflege hinaus. Das Thema birgt Konflikte, gerade zwischen teils übermächtigen Wohnungsgesellschaften und deren Mietern. Ihnen wird häufig nur eine Nebenrolle zugestanden, obwohl sie ihr Leben in dem zur Verfügung gestellten Wohnraum gestalten müssen.
Für "konzertierte" Aktionen, die alle einbeziehen, bieten am Gemeinwohl orientierte Baugenossenschaften gute Voraussetzungen. Es gibt rund 2.000 in Deutschland. Sie unterhalten über zwei Millionen Wohnungen und wirtschaften zugunsten ihrer mehr als drei Millionen Mitglieder. Durch ihre Anteile sind diese Miteigentümer am großen Ganzen, existentiell abgesichert, nahezu unkündbar und fühlen sich in der Verantwortung für Haus und Garten. Allein in Berlin werden von über 80 Wohnungsbaugenossenschaften mehr als 180.000 Wohnungen verwaltet. Ein paar gelungene Projekte, die ein harmonisches Erscheinungsbild auszeichnet, möchte Ihnen Monumente vorstellen.
Professor Dr. Dr. h. c. Gottfried Kiesow, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
"Wenn es uns gelingt, den betroffenen Eigentümern, das heißt den gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften (…) den Denkmalwert ihrer Siedlungen deutlich zu machen, wenn es uns dann auch noch gelingt, den Denkmalwert den Bewohnern und den politischen Verantwortlichen in den Kommunen und Ländern deutlich zu machen, haben wir, meine ich, zumindest 90 Prozent aller Schwierigkeiten bewältigt. Für die restlichen zehn Prozent werden sich dann sicherlich Lösungen finden lassen." Berlin 1985
Berlin-Wedding: Hoffmann-Bauten in der Siedlung Schillerpark
Ein Gemeinschaftswerk vieler Parteien, über das sich nicht allein die Mieter freuen, sind die sanierten Häuser mit lichtdurchfluteten Wohnräumen von Hans Hoffmann. Er errichtete sie 1955-59 in Berlin-Wedding. Sie stehen in direkter Nachbarschaft zum Unesco-Welterbe-Gebiet "Siedlung Schillerpark" und werden von Architekturliebhabern aus der ganzen Welt besichtigt. Die drei bis viergeschossigen Häuser folgen dem Leitbild des "transparenten Wohnens" nach Vorstellungen von Bruno Taut. Mit großen, geschosshohen Fenstern, durchgehenden Balkonen und begehbaren Blumenfenstern interpretierte der Architekt Hoffmann die Verbindung von Wohn- und Außenraum im klaren, geradlinigen Stil der Nachkriegszeit.
Die Hauszeilen mit 112 Wohnungen wurden kürzlich mit dem Deutschen Bauherrenpreis 2013 und dem Sonderpreis "Denkmalschutz im Wohnungsbau" für die energetische Modernisierung ausgezeichnet. Den Sonderpreis vergibt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz: Bauherr und Planer stimmten sich im Wedding vorbildlich mit den Denkmalpflegern ab, holten die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und die TU Dresden für Fragen der Klimatechnik mit ins Boot. Auf Mieter-Versammlungen erläuterte die Genossenschaft ihre Vorgehensweise. Besonders ältere Bewohner, die während der Bauarbeiten zu stark belastet gewesen wären, konnten Gästewohnungen beziehen.
Gerne kehrten die Menschen in die Siedlung zurück, zumal sich die Mieten kaum erhöht und die Heizkosten reduziert hatten. Das Ergebnis der energetischen Sanierung ist ein Jahresprimär-Energiebedarf, der von 310 auf 55 kWh/m² gesenkt wurde und vergleichbar mit Werten für Neubauten ist. Hier wurde in die Tat umgesetzt, was sich der langjährige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Professor Dr. Gottfried Kiesow, auf einer Berliner Tagung 1985 gewünscht hatte: das Zusammenspiel aller Kräfte rund um historisch bedeutende Siedlungen.
Denn auch die Denkmalpflege kam auf ihre Kosten. Die Ästhetik der Hoffmann-Bauten blieb unangetastet. Architekten und Ingenieure gingen schonend mit dem Bestand um und erhielten so viel Originalsubstanz wie möglich. Die Verglasung und die Stahlprofile der Treppenhausfenster von nur 30 Millimetern Breite wurden aufgearbeitet. Die Blumenfenster tragen nun durch ein ausgeklügeltes System zur Lüftung bei.
Nicht überall wird man derart vorbildlich agieren können. Am Schillerpark bot sich diese Chance für die Bauherrin, die Berliner Wohnungsbaugenossenschaft von 1892 eG, im Aufwind des 2008 verliehenen Welterbetitels. Die Freude darüber und die Verantwortung für die Bausubstanz setzte Energie für innovative Lösungen frei. Es war klar, dass es aufwendiger sein würde, eine Weltkulturerbestätte zu erhalten als die Häuser "normal" zu bewirtschaften. Die Genossenschaft gründete daher die "Stiftung Weltkulturerbe Gartenstadt Falkenberg und Schillerpark-Siedlung der Berliner Moderne", um das Mehr an Pflege bewältigen und andere Geldquellen erschließen zu können. Die Kosten sollten nicht zu Lasten der übrigen 6.500 Wohnungen der Genossenschaft gehen.
Gerhard Eichhorn, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Bonn 2013
"Denkmalschutz verbindet man zuerst mit Schlössern, Kirchen und Bürgerhäusern. Denkmalwert haben aber auch Zeugnisse der Technikgeschichte, historische Grünanlagen und Siedlungen. Sie geben unseren Städten ihr unverwechselbares Gesicht und bieten den Menschen eine individuelle Heimat, so wie die preisgekrönte Siedlung Schillerpark in Berlin-Wedding. Das Bewusstsein für den Denkmalwert solcher Siedlungen zu schärfen - beim Eigentümer, bei den Mietern, bei den die Sanierung planenden Berufen und schließlich bei den ausführenden Handwerkern -, auch das gehört zum Satzungsauftrag der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Deshalb beteiligt sich die Stiftung gerne als Mitausloberin beim Deutschen Bauherrenpreis, Kategorie Modernisierung, und in diesem Rahmen als Ausloberin des Sonderpreises 'Denkmalschutz im Wohnungsbau'."
Berlin Treptow-Köpenick: Gartenstadt Falkenberg, "Tuschkasten"
Freiwillig ziehen nicht viele Menschen aus der Gartenstadt Falkenberg fort. Das Konzept des Architekten Bruno Taut, "die einfachen Bedürfnisse klar und unumwunden" zu befriedigen, um somit "ohne architektonische Scherze" direkt "zum Gefühl sprechen" zu können, ist nun schon ein Jahrhundert aufgegangen. Die Siedlung im südlichen Berlin wirkt durch die Anstriche fröhlich und abwechslungsreich. Bruno Taut setzte hier erstmals Farbe als gestalterisches Element für einen ganzen Stadtraum ein und verzichtete stattdessen weitgehend auf Zierformen wie Erker und Treppentürmchen. Mieter, deren Großeltern den Bau der Siedlung 1913-16 miterlebt haben, fühlen sich noch heute in den 45, 52 oder 77 Quadratmeter großen Wohnungen wohl. Mit viel Liebe pflegen sie ihre Hausgärten, in denen nach wie vor Ställe und Lauben stehen.
Die von Taut weiterentwickelte Gartenstadt-Idee Ebenezer Howards vereint Städtisches und Ländliches, geschwungene Straßen und unregelmäßige Bebauung wie in einem gewachsenen Dorf - dies aber mit direktem Verkehrsanschluss an den Alexanderplatz. Auf einer buckligen Fläche von 70 Hektar sollte es rund 1.500 Wohnungen für 7.000 Menschen geben. Der Erste Weltkrieg durchkreuzte die Pläne, und es wurde nur ein Bruchteil der ursprünglichen Konzeption verwirklicht.
Der Anstriche wegen beschimpfte man Bruno Taut als "verhaftungswürdig". Die Bezeichnung "Tuschkastensiedlung" war nicht freundlich gemeint, sondern eine beißende Kritik an den Farben und Mustern der Fassaden. Heute ist die Gartenstadt mit ihrer markanten Erscheinung so begehrt, dass die Wartezeit auf Wohnraum viele Jahre betragen kann. Das war schon so, ehe sie 2008 Welterbe wurde. Ein Mann der ersten Stunde ist Max Rasokat. Er wohnt in einem Reihenendhaus am Akazienhof. "Meine Großeltern sind 1913 hier eingezogen, ich wurde 1945 hier geboren, und auch meine Kinder und Enkel leben hier", erzählt er. Rasokat erinnert sich gern an seine Kindheit, als alle - wie noch heute - auf der Straße und damals im nahegelegenen Wald spielten.
Schon in den 1980er-Jahren war die Siedlung modernisiert worden. Nach der Wende nahm sich die Genossenschaft jedes Jahr ein paar Häuser vor, legte neue Leitungen, setzte Dächer und Pergolen instand, erneuerte wo nötig die Fenster und den Fassadenputz - dies alles, ohne dass die Mieter ausziehen mussten.
Die Architektin Claudia Templin arbeitete schon für die Berliner Wohnungsbaugenossenschaft von 1892 eG, als diese sich für den Welterbe-Titel bewarb. Damals fragte Icomos unter anderem nach Denkmalpflege-Plänen. Die gab es tatsächlich. Es waren Gutachten erstellt worden, wie mit der Originalsubstanz umgegangen werden könnte - mit den farbigen Fassaden, Türen, Fenstern und den Holzklappläden - und natürlich mit den Gärten. In ihnen sind heimische Gehölze, gern ein Obstbaum, aber keine Koniferen erwünscht. Diese Ratschläge sind so auch im Nutzervertrag verankert, gedacht als Hilfe, nicht um zu maßregeln. Denn schließlich steht das Welterbe nicht unter einer Glasglocke, sondern in der Siedlung soll gelebt werden - und dies so glücklich und frei wie möglich. Die Zeit steht nicht still: Seit 2002 errichtet die Genossenschaft auf dem freien Gelände am Falkenberg neue Häuser, die den Gartenstadtgedanken mit großzügigen öffentlichen Grünflächen im Sinne des dritten Jahrtausends deuten.
Claudia Templin, Architektin der Berliner Wohnungsbaugenossenschaft von 1892 eG und von der Stiftung Weltkulturerbe Gartenstadt Falkenberg und Schillerpark-Siedlung der Berliner Moderne, Berlin 2013
"Es ist eine spannende Aufgabe, unseren Mietern, von denen viele seit mehreren Generationen in der Falkenberg-Siedlung leben, den historischen Wert ihrer Häuser und Wohnungen nahezubringen. Wir erläutern, wie wohldurchdacht vor dem Ersten Weltkrieg die Gärten und Vorgärten gestaltet worden sind, und geben Tipps, wie sie, zum Beispiel mit Buschröschen, nach altem Vorbild bepflanzt werden können. Manche Mieter sind regelrecht begeistert und werden zu Gartenfreunden. Die Besucher, die aus vielen Ländern nach Berlin kommen, um die Architektur von Bruno Taut und seine "Tuschkastensiedlung" zu sehen, werden freundlich empfangen, manchmal sogar spontan durch die Siedlung geführt. Sobald neue Mieter einziehen, versuchen wir, auch sie von der Genossenschaftsidee und der Freude am Denkmal zu überzeugen."
St. Ingbert: Ehemalige Werkssiedlung "Alte Schmelz"
Den Menschen in der Alten Schmelz von St. Ingbert bei Saarbrücken bedeutete ihre Siedlung bis in die 1990er-Jahre hinein nicht sehr viel. Sie wohnten dort zwar nahezu zum Nulltarif und ihr Arbeitsplatz lag nur einen Steinwurf entfernt. Aber im gleichen Maße, wie Produktion und Belegschaft im Drahtwerk vom Niedergang bedroht waren, nahm die Sorgfalt der Mieter ab, ihre Häuser zu pflegen. Mutlosigkeit machte sich breit. Es ging erst wieder aufwärts, als die Bewohner nach längerem Ringen 1995 die Genossenschaft gründeten. Die Siedlung war inzwischen zusammen mit 14 Produktionsstätten und Direktorenvillen als Ensemble unter Denkmalschutz gestellt worden.
Der ehemalige Landtagspräsident des Saarlands, Albrecht Herold - er wuchs in der Alten Schmelz auf -, der Architekt Jürgen Recktenwald und der damalige Landeskonservator Johann Peter Lüth unterstützten die Bewohner mit allen Kräften. Das marode Industriegebiet mit einer der ältesten Arbeitersiedlungen Südwestdeutschlands, deren Anfänge bis in den Spätbarock zurückreichen, war in der Stadt verrufen. In den Jahren der Sanierung wandelte sich das: Jürgen Recktenwald, der seine Diplomarbeit über die Alte Schmelz verfasst hatte, bezog die Mieter mit ein und erklärte ihnen in persönlichen Gesprächen, warum originale Haustüren und Fenster, auch Fliesen und Treppen im Inneren, erhalten werden sollten. Der vorgegebene gelbe Farbanstrich und die grünen Fensterläden schufen ein einheitliches Bild, das fast allen gefiel und bis heute unverändert blieb. Beim Gestalten der Gärten hingegen ließ man in St. Ingbert den Mietern freie Hand.
Hätte man die Wohnungen privatisiert, wäre wohl das passiert, was überall im Land zu beobachten ist: Tausende Geschmäcker auf engem Raum verändern das Bild bis zur Unkenntlichkeit. Die einen nennen es Individualismus, die anderen beklagen, dass der Charakter der Siedlung zerstört wurde.
Vom modernen Wohnkomfort ist die Alte Schmelz weit entfernt. Aus heutiger Sicht sind die Wohnzimmer sehr klein und die Bäder bescheiden. Dass ihre Häuser ein Dokument für das autoritärpatriarchale System der Unternehmen des 18. und 19. Jahrhunderts darstellen und anschaulich vermitteln, wie eng - auch räumlich - Arbeiten, Wohnen und Viehzucht einst zusammenhingen, beeindruckte anfänglich kaum jemand, war mehr Last als Lust. Durch die Aufmerksamkeit der Politik und die stete Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz veränderte sich im Verlauf der Restaurierung das Selbstverständnis der Mieter. Sie wissen, dass sie Teil eines Projekts sind, auf das das Saarland stolz ist. Denkmalpflege in St. Ingbert ist ein Akt der Aufklärung und der Sozialpolitik.
Die Menschen dort nennen die Siedlung inzwischen ihr Eigentum. Während für die Siedlung eine tragfähige Lösung gefunden wurde, plant Alfons Blug mit seiner Initiative Alte Schmelz St. Ingbert e. V. einen "MINT-Campus". Denn auch die Mechanische Werkstatt, die Möller-Halle, das Herrenhaus und das Konsumgebäude stehen unter Denkmalschutz und gehören zum Ensemble. Ihm schwebt ein Freizeitzentrum vor, eine Art Abenteuerspielplatz für Jugendliche, die an Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) Freude haben und dies praktisch anwenden möchten. Damit entwickelt er die Tradition des 280 Jahre alten Industrieareals weiter. Auch für seine Ideen gilt, was für die Siedlungen richtig ist: Wenn Partner und Geldgeber ein gemeinsames Ziel vor Augen haben, steht Alfons Blugs Plänen nichts im Wege.
Heike Bruch, Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft Albrecht Herold - Alte Schmelz - eG, St. Ingbert 2013
"In den 1980er-Jahren sah es so aus, als würde die Werkssiedlung Alte Schmelz abgerissen werden. Wir hatten Angst, unser Zuhause zu verlieren. Der Arbeiterverein, in dem alle Bewohner Mitglied waren, schlug Alarm und erwarb die Häuser für eine Mark. Wir hatten vor, eine Genossenschaft zu gründen. Viele waren skeptisch. Die Überzeugten mieteten damals einen Bus und reisten gemeinsam mit den Zweifelnden in genossenschaftlich verwaltete Siedlungen. Sie wollten ihnen die Furcht davor nehmen, Anteilseigner zu werden. Außerdem konnten wir uns unterwegs wertvolle Tipps holen. 1995 wurde die Genossenschaft tatsächlich ins Leben gerufen, und jeder steuerte einen Anteil von 10.000 Mark für den Einbau von Heizung und Bad bei."
Christiane Schillig
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Die neue Lust am Bungalow 08.11.2012 Bungalows Die Leichtigkeit des Steins

Fast 17 Millionen Dollar. Das ist auch für das Auktionshaus Christie's keine alltägliche Summe. Bei 16,8 Millionen Dollar ist im Mai bei einer Auktion in New York für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst der Zuschlag erfolgt, und zwar für - und das ist ebenso ungewöhnlich - ein Bauwerk. Nicht einmal ein besonders großes.
-
Mittelalterliche Wandmalereien in Behrenhoff 16.01.2018 Die Hölle Vorpommerns Die Hölle Vorpommerns

In der Dorfkirche von Behrenhoff haben sich eindrucksvolle Darstellungen des Fegefeuers erhalten.
-
Otto Bartning und seine Kirchen 09.03.2016 Bartning Kirchen Spiritualität in Serie

Otto Bartning gehört zu den bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Wegweisend sind seine Raumschöpfungen im Bereich des protestantischen Kirchenbaus.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
Lesen Sie 0 Kommentare anderer Leser
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz