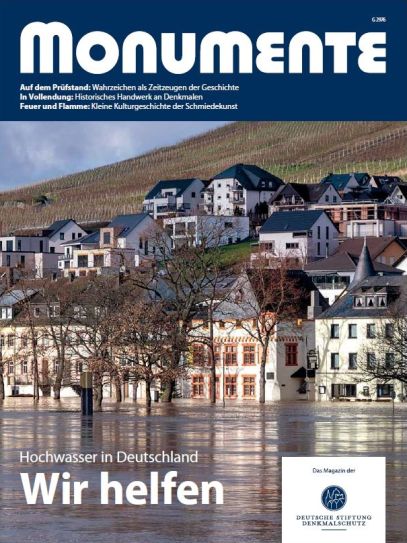Schlösser und Burgen Herrscher, Künstler, Architekten Menschen für Denkmale
Das Zerbster Schloss muss weiter gesichert werden
Begeisterung für einen Torso
Am 16. April 1945 wurde Zerbst, das man das mitteldeutsche Rothenburg nannte, zu 80 Prozent zerstört. 573 Menschen starben und viele bedeutende Bauwerke wurden zu Ruinen. Das barocke Residenzschloss der Fürsten von Anhalt-Zerbst, einer der größten Schlossbauten Sachsen-Anhalts, brannte damals aus. Nur der Ostflügel blieb erhalten, der in den letzten Jahren dank eines rührigen Fördervereins gesichert wurde. Doch es bleibt noch viel zu tun.
Dabei hätte das Bombardement verhindert werden können. Doch der Aufforderung, Zerbst der amerikanischen Armee kampflos zu übergeben, kamen der NSDAP-Kreisleiter und der zuständige Kommandant nicht nach, Bitten der Einwohner wurden ignoriert. Immer noch künden in Zerbst die Ruinen von St. Nikolai und St. Bartholomäi sowie des Schlosses von diesem Frevel.
Seit 1921 war in der mächtigen Dreiflügelanlage ein Museum mit kunst-, kultur- und vorgeschichtlichen sowie naturwissenschaftlichen Sammlungen untergebracht, dazu bedeutende Archive und städtische Einrichtungen. Ein großer Teil der wertvollen Exponate und Archivalien ging durch den Brand und spätere Plünderungen verloren.
Dass heute nur noch der Ostflügel steht, hatte 1948 allerdings der damalige Zerbster Oberbürgermeister zu verantworten. Er ließ das Corps de Logis und den Westflügel sprengen und die massiven, teilweise mehr als zwei Meter dicken Mauern, die der Zerstörung getrotzt hatten, mit großem finanziellen Aufwand abtragen. Es wäre vermutlich günstiger gewesen, die Ruine zu sichern. Der Ostflügel und ein Fragment des Corps de Logis blieben erhalten, weil Dr. Wolf Schubert, damals Landeskonservator Sachsen-Anhalts, gegen den Abriss protestierte.
So überstand der Torso - seit 1954 teilweise durch ein Notdach geschützt - die folgenden Jahrzehnte mehr schlecht als recht. Ein Hoffnungsschimmer erschien am Horizont, als zwei Bauunternehmer die Ruine 1990 kauften. Sie planten, die Dreiflügelanlage wieder aufzubauen und in ihr ein 5-Sterne-Hotel mit 450 Betten einzurichten. Im ehemaligen Reithaus sollte ein Spielkasino entstehen. Doch der Traum platzte, und ungeklärte Eigentumsverhältnisse verhinderten in den folgenden Jahren eine Sicherung der Ruine.
Der Ostflügel stammt aus der fünften und letzten Bauphase des Schlosses, das ab 1681 errichtet wurde. Das Fürstentum war nach dem Dreißigjährigen Krieg ausgeblutet, erlebte jedoch unter Carl Wilhelm von Anhalt-Zerbst (1652-1718) eine bescheidene wirtschaftliche Blüte. Dennoch fehlten die Mittel, um die mächtige Dreiflügelanlage in einer einzigen Bauphase errichten zu können. Der Fürst ließ zunächst einen Teil der baufälligen Burg, in der er aufgewachsen war, abtragen und an dieser Stelle das Corps de Logis errichten. Als Baumeister verpflichtete er den Niederländer Cornelis Ryckwaert, der in preußischen Diensten stand und Pläne für die Gesamtanlage entwarf. Die Gestaltung der Räume mit prächtigen Decken und Kaminen übernahm der Stuckateur Giovanni Simonetti, der nach Ryckwaerts Tod 1693 die Bauleitung innehatte. Am 23. Juni 1696, dem 42. Geburtstag der Fürstin Sophia, wurde das Schloss eingeweiht und von der fürstlichen Familie bezogen.
1703 war es Carl Wilhelm möglich, das Schloss durch einen Westflügel zu ergänzen. Die Fertigstellung dieses Traktes, der die Schlosskapelle aufnahm, erlebte der Fürst nicht mehr. Sein Sohn Johann August (1677-1742) ließ den Mittelrisalit des Corps de Logis zu einem mächtigen Turm umgestalten und den Westflügel durch einen Pavillon erweitern. Die Anlage wurde ab 1744 durch den Ostflügel vervollständigt - in dem Jahr, als die anhaltische Prinzessin Sophie Auguste Friederike, die spätere Zarin Katharina die Große, von Zerbst aus nach Moskau aufbrach. Dort heiratete sie im September 1745 den russischen Thronfolger Peter Fjodorowitsch.
Die Fürsten ließen ihre privaten Wohn- und Repräsentationsräume in der Beletage des Ostflügels durch Johann Michael Hoppenhaupt d. Ä., den Bildhauer Friedrichs des Großen, prächtig ausgestalten.
Wie prächtig, zeigen Fotos aus dem Jahr 1927 und einige Farbaufnahmen von 1942. Einen besonderen Eindruck von der historischen Ausstattung erhält man heute in einem Raum, der ursprünglich als Zweites Fürstliches Vorzimmer diente. Schwarz-Weiß-Drucke an den Wänden und Decken visualisieren hier die Ausgestaltung mit Tapisserien, Rocailles, Kaminen und Fliesen aus der Zerbster Fayence-Manufaktur - am Computer zusammengestellt von dem Informatiker Dirk Herrmann, dem Gründer des Fördervereins Schloss Zerbst e. V. Bereits als Schüler hatte er sich in den 1970er Jahren mit dem Schloss beschäftigt, das damals von der Bevölkerung kaum mehr wahrgenommen wurde. Das Ensemble, das eine große Rolle in der Geschichte Zerbsts gespielt hatte, fesselte ihn so sehr, dass er in der zehnten Klasse ein Modell der barocken Dreiflügelanlage anfertigte.
Als das Schloss 1999 wieder in das Eigentum der Stadt zurückfiel, reifte in ihm der Wunsch, sich für den Torso einzusetzen. Angesichts des schlechten Erhaltungszustandes, verursacht durch Witterungseinflüsse und Vandalismus, hielten ihn viele für einen Fantasten. "Wir wussten nicht, wie wir das stemmen sollten, aber wir wollten das Schloss unbedingt retten", beschreibt Dirk Herrmann die Devise des Fördervereins, der im März 2003 gegründet wurde.
Zunächst räumten die Vereinsmitglieder in zahllosen Wochenendeinsätzen Tonnen von Schutt aus dem Schloss und befreiten das Mauerwerk vom Unkraut. Türbeschläge, Ofenkacheln, Scherben, Türblätter, Fensterrahmen und weitere Fragmente der ursprünglichen Ausstattung wurden geborgen. Bereits zum Tag des offenen Denkmals 2003 bot der Verein erste Führungen an. Dass damals 2.000 Besucher kamen, machte Mut, die Arbeit fortzusetzen.
Mit Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt, des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, der Stadt Zerbst, der Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt und weiterer Geldgeber, doch auch mit einem hohen Eigenanteil wird die Schlossruine seither Schritt für Schritt gesichert. Das Notdach erhielt eine neue Deckung, man besserte das Mauerwerk aus, zog Stahlbetondecken ein und schloss die Fenster mit Glas oder Glasfolie. Der Sandsteinfußboden im Erdgeschoss und die Gewölbe im Corps de Logis wurden saniert und eine Statue, die auf dem Balkon des Mittelrisalits gestanden hatte, restauriert. Die Fensterrahmen nach historischem Vorbild sowie die provisorischen Holztüren stellt der Förderverein selbst her.
Mittlerweile konnten einige Ausstellungsräume hergerichtet werden, in denen der Verein Funde, Porträts, originale Kupferstiche, Fragmente der stark beschädigten Särge aus der Fürstengruft und vieles mehr zeigt. Außerdem gibt es Bereiche, die vom Internationalen Förderverein Katharina II. e. V. mit Exponaten zum Leben und Wirken der Zarin ausgestattet wurden. In drei Räumen wird an den Hofkapellmeister Johann Friedrich Fasch erinnert, den Fürst Johann August 1722 nach Zerbst holte.
Der Förderverein Schloss Zerbst e. V. hat viel bewirkt, und dennoch gibt es immer noch Bereiche, die bislang nicht gesichert werden konnten und die weiterhin ungeschützt der Witterung ausgesetzt sind. Es handelt sich um den Südbereich des Ostflügels, den sogenannten Pavillon, und den Teil des Corps de Logis, der sich im Norden an den Ostflügel anschließt und 1948 nicht abgetragen wurde.
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz möchte sich an der Sicherung des Mauerwerks beteiligen und bittet Sie, liebe Leserin und lieber Leser, um Ihre Mithilfe. Damit wenigstens das, was von einem der prächtigsten Barockschlösser Mitteldeutschlands übrig blieb, für weitere Generationen bewahrt werden kann.
Carola Nathan
Weitere Infos im WWW:
www.schloss-zerbst-ev.deDiese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Otto Bartning und seine Kirchen 09.03.2016 Bartning Kirchen Spiritualität in Serie

Otto Bartning gehört zu den bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Wegweisend sind seine Raumschöpfungen im Bereich des protestantischen Kirchenbaus.
-
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther 04.07.2017 Ulrich Müther Hyparschalen

Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
-
Von Seekisten und Seeleuten 08.11.2012 Seekisten Was auf der hohen Kante lag

In den alten Zeiten der Frachtsegler musste die gesamte Habe des Seemanns in eine hölzerne Kiste passen. Manchmal liebevoll bemalt, war sie das einzige persönliche Stück, das ihn auf seinen Reisen über die Weltmeere begleitete.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz