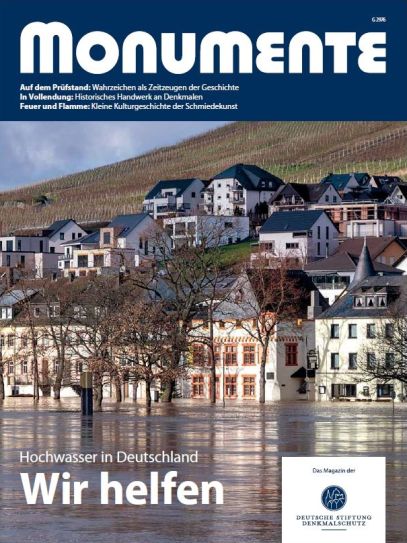Kleine und große Kirchen Gedenkstätten Juni 2012 S
Erst mit der Gleichberechtigung kam die Blüte
Synagogen als Bauaufgabe
Sechs Tage der Woche kämpfen wir mit der Welt, ringen wir dem Boden seinen Ertrag ab; am Sabbat gilt unsere Sorge vor allem der Saat der Ewigkeit, die in unsere Seele gesenkt ist. Abraham J. Heschel (1907-1972)
Dieser Text ist eine Einstimmung auf den Sabbat-Gottesdienst am Freitagabend, geschrieben von einem jüdischen religiösen Denker des 20. Jahrhunderts, Abraham Jehoschua Heschel.
Viele kennen zwar jüdische Gedenkstätten und jüdische Museen. Den Gottesdienst in einer Synagoge allerdings haben nur wenige Nichtjuden besucht. Dabei ist das ohne weiteres möglich, und er ist weniger fremd, als die meisten vielleicht annehmen. In der biblischen Überlieferung haben christlicher und jüdischer Gottesdienst eine gemeinsame Grundlage. Für beide sind Schriftlesung, Gebet und Gesang wesentliche Elemente, beide kennen einen festen Ablauf, die Liturgie.
Wenn Sie sich zum Besuch eines Gottesdienstes entschließen sollten, ist es ratsam, sich bei der Gemeinde, die Sie besuchen möchten, telefonisch anzumelden. Gäste sind überall willkommen, Vorsichtsmaßnahmen aber leider berechtigt. Es gibt Sicherheitsauflagen, und unbekannte Einzelpersonen werden ohne Anmeldung oftmals nicht hineingelassen.
Weil historische Synagogen im Stadtbild vieler deutscher Ortschaften heute fehlen und die erhaltenen in größeren Städten meist zu Erinnerungsstätten oder Museen umfunktioniert wurden, sind sie als lebendige religiöse Zentren nahezu aus unserem Bewusstsein verschwunden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es etwa 2.800 Synagogen und Betstuben in Deutschland. Davon wurden weit über die Hälfte zerstört, der größte Teil während der Nacht vom 9. zum 10. November 1938, ein weiterer Teil durch Bomben im Krieg. Von denen, die den Pogrom und den Krieg überstanden hatten, wurden die meisten zweckentfremdet, verkauft oder abgerissen. Den brandschatzenden Nationalsozialisten war bekannt, dass eine geschändete Synagoge nicht ohne weiteres wieder als Gebetshaus dienen durfte. So sind nicht nur die Erinnerungen an eine einst blühende Baugattung in Deutschland seit 1938 fast ausgelöscht, sondern auch unsere Kenntnisse über ihre angestammte liturgische Nutzung. Jüdisches Leben, das auf dem Land vielfach in unauffälligen, "geschichtslosen" Gemeinderäumen aufkeimt oder in neu errichteten Synagogen in den Städten, gehört für viele noch immer nicht zum deutschen Alltag.
Grundsätzlich können Synagogen so unterschiedlich gestaltet sein wie christliche Kirchen auch. Die Synagoge ist eher ein geistiges, vor allem ein gesellschaftliches denn ein baukünstlerisches Gebilde, ein Haus der Zusammenkunft, des Lernens und des Betens. Für die Gestaltung des Innenraums sind zwei Elemente ganz wichtig, die architektonisch fast immer hervorstechen: der gewöhnlich nach Jerusalem ausgerichtete, in die Ostwand eingelassene Toraschrein (Aron Hakodesch), der die Schriftrollen (die von Hand geschriebenen fünf Bücher Mose) birgt, - er ist Sinnbild für die Bundeslade mit den Gebotstafeln - und das erhöhte Pult für die Lesung aus der Tora (Bima) im Zentrum des Raumes.
Die Synagoge als Versammlungsstätte für den jüdischen Gebets- und Lesegottesdienst entwickelte sich langsam im babylonischen Exil: 587 vor Christus zerstörten die Babylonier den salomonischen Tempel der Juden in Jerusalem. Deshalb mussten sie sich im Exil mit Provisorien behelfen. Auch später nach der Rückkehr bildete sich noch keine eigene Synagogenarchitektur aus. In der Diaspora lehnten sich jüdische Gemeinden an den herrschenden Baustil des jeweiligen Landes an. Über ein Jahrtausend hindurch wurden die Bauten einer gesellschaftlich ausgegrenzten Minderheit kaum wahrgenommen, zumal Gotteshäuser meist nur am Ortsrand oder in Hinterhöfen errichtet werden durften. Im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert lebten die Juden in der Mehrzahl in Landgemeinden oder sehr kleinen Städten, weil es in den größeren strenge Zulassungsbeschränkungen gab. Gottesdienste wurden in schlichten Betsälen oder in Privathäusern abgehalten. Wohlhabendere Gemeinden konnten sich ein eigenes Kultgebäude leisten, in dem dann nicht nur der Gottesdienst, sondern auch Schulunterricht für die Kinder und das Studium des Talmuds stattfanden.
Dies änderte sich mit den Emanzipationsbestrebungen der Juden zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Für Gottesdienste zogen sie sich nicht länger in Wohnzimmer und Hinterhöfe zurück. Besonders nach der Reichsgründung von 1871, als Juden vor dem Gesetz gleichgestellt waren, zeigten sie stolz ihre Präsenz mit monumentalen Bauten in den großen Städten. Die Entwicklung des Bautyps hing von der jeweiligen Gesetzeslage ab, vom Maß der Freiheit, das die Juden erlangten. Seit den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts wurden die Bauten aufwendiger, im Stadtbild erkennbar, eine volle gesetzliche Gleichberechtigung schien sich anzubahnen.
Das Bauen von Synagogen wurde im 19. Jahrhundert zur lohnenden Aufgabe - zumeist für christliche Architekten. An den Wettbewerben nahmen alle Stararchitekten der damaligen Zeit teil, darunter Gottfried Semper und der Kölner Dombaumeister Ernst Friedrich Zwirner. Weil Vorbilder und ein Idealtypus fehlten, war die allgemeine Unsicherheit ebenso groß wie der Spielraum. Die Blüte des Synagogenbaus fiel mit dem Eklektizismus zusammen, als praktisch alles erlaubt war und intensiv darüber diskutiert wurde, in welchem "Style" denn nun am besten gebaut werden solle. Friedrich Weinbrenner beispielsweise wählte 1806 für die Synagoge in Karlsruhe einen ägyptisierenden Stil, der signalhaft die Sonderstellung und Fremdartigkeit der Juden in der Stadt ins Licht rückte. So galt eine orientalisierende Formensprache vielen als perfekte Lösung, weil sie die Ursprünge des Judentums betonte und gleichzeitig eine klare Abgrenzung vom christlichen Sakralbau bedeutete. Der maurische Stil mit Hufeisenbögen hielt sich bis in die neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts als Zeichen der Selbständigkeit deutscher Juden.
Die Stilwahl war keine Frage des Geschmacks, sondern sie betraf die jüdische Identität und hatte den Charakter eines Bekenntnisses: Viele jüdische Gemeinden wollten nach außen zeigen, dass sie sich genau wie Christen vor allem als Deutsche betrachteten. Jüdische Kultarchitekturen sollten nicht länger wie Stein gewordene Märchen aus tausendundeiner Nacht aussehen. Der jüdische Architekt Edwin Oppler (1831-80), einer der ersten, die sich auf den Synagogenbau spezialisierten, löste den Konflikt, indem er monumentale Synagogen für Hannover, Breslau und München im Stil der rheinischen Romanik des 12. Jahrhunderts verwirklichte, dem Stil, der seiner Ansicht nach "mit Recht als der rein deutsche bezeichnet werden kann" und der dann bald zum beliebtesten avancierte.
Aus diesem Dilemma - einem Spiegelbild gesellschaftlicher Stigmatisierung - gab es kein Entrinnen: Errichteten jüdische Gemeinden ihre Synagogen selbstbewusst in orientalisierenden Stilen, dann liefen sie Gefahr, sich optisch auszugrenzen. Planten sie ihre Gotteshäuser in "deutschen" Stilen, dann brachte ihnen das rasch den Vorwurf der Selbstverleugnung ein. Aber gleichgültig, ob sie sich nun für den deutschen "Nationalstil" entschieden oder für eine exotische Bauweise, das Nazi-Regime verschonte keine Synagoge.
Als 1938 in Deutschland die Synagogen brannten, endete für jedermann sichtbar eine wichtige Epoche deutschjüdischer Geschichte: 150 Jahre mühsam erkämpfte Gleichstellung wurde mit den Flammen einer Nacht vernichtet. Viele erhaltene Synagogen, besonders die auf dem Lande, sind nur deshalb den Zerstörern entgangen, weil sie zu dicht neben anderen Häusern standen, und es daher zu riskant war, sie in Brand zu setzen.

Wissen über Synagogen und damit auch Kenntnisse über jüdische religiöse Grundlagen in unseren Alltag zurückzuholen, daran arbeiten Bürgerinitiativen, Kulturvereine und Denkmalpfleger sowohl in den Städten als auch auf dem Lande. Nach dem Holocaust kehrten nur sehr wenige Juden zurück. Nicht zerstörte Synagogen wurden als Wohnhäuser, Scheunen, Lagergebäude, Turnhallen, als Matratzenfabrik (Hemsbach), Teppichweberei (Rottweil) oder zu Gaststätten umgebaut und sind oft bis zur Unkenntlichkeit verändert. Viele, die als Denkmale eingetragen sind, wurden seit den 1960er und vermehrt ab den 1980er Jahren mit Fingerspitzengefühl als Gedenkstätten hergerichtet. Aber sie stehen lange nicht so im Blickpunkt wie ihre großen Schwestern in Berlin an der Oranienburger Straße, in Köln an der Roonstraße oder in Essen an der Steeler Straße. In Essen gelang es bereits 1980, einen Teil des Baukomplexes zur Begegnungsstätte Alte Synagoge umzuwidmen. Auf diese Weise diente die gebrandschatzte Synagoge als lebendiger und anregender kultureller Treffpunkt. Dort debattierten Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion offen über Politik, Glauben und Historisches und versuchten, der gemeinsamen Geschichte mit Respekt und zugleich weniger ängstlich zu begegnen. Von 2008 bis 2010 wurde das Konzept weiterentwickelt, und es entstand ein Haus der interkulturellen Begegnung mit der jüdischen Kultur in fünf Ausstellungsbereichen. Informiert wird über die Quellen jüdischer Traditionen, jüdischer Feste und die Geschichte der jüdischen Gemeinde Essen.
Christiane Schillig
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Von Seekisten und Seeleuten 08.11.2012 Seekisten Was auf der hohen Kante lag

In den alten Zeiten der Frachtsegler musste die gesamte Habe des Seemanns in eine hölzerne Kiste passen. Manchmal liebevoll bemalt, war sie das einzige persönliche Stück, das ihn auf seinen Reisen über die Weltmeere begleitete.
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther 04.07.2017 Ulrich Müther Hyparschalen

Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
Lesen Sie 1 Kommentar anderer Leser
-
 Bernd Rocksien schrieb am 04.04.2016 09:51 Uhr
Bernd Rocksien schrieb am 04.04.2016 09:51 UhrHochinteressant!
Auf diesen Kommentar antworten
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz