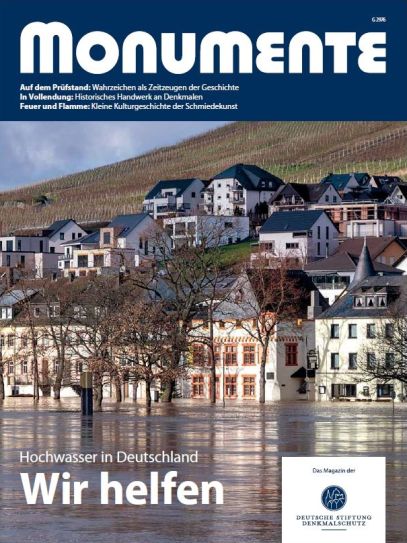Öffentliche Bauten Kurioses Ikonographie Februar 2012
Ein sagenhaftes Ereignis in der Kölner Stadtgeschichte
Dem Löwen zum Fraße
Der schwarze Mantel des Hermann Grin bauscht sich in der Luft, als dieser mit festem Schritt dem aufgerichteten Löwen entgegentritt. Entschlossen hat der blutrot Gewandete sein Schwert in die Brust des Raubtieres gerammt und wehrt mit dem Stoß seiner vom Umhang geschützten Linken dessen Biss ab.
Das heute im Kölnischen Stadtmuseum ausgestellte Gemälde aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zeigt eine Legende, der bereits die Kölner Chronik von 1499 eine detaillierte Beschreibung widmet: Im Jahr 1262 hielt sich der Kölner Erzbischof Engelbert II. einen Löwen, dessen Gefährlichkeit sich noch erweisen sollte. Aufgezogen wurde das Tier von zwei adeligen Mitgliedern des Domkapitels, die in der Gunst Engelberts standen. Sie erdachten eine List, um den unliebsamen Bürgermeister Hermann Grin zu beseitigen, da dieser sich nicht der Einflussnahme des Erzbistums beugen wollte. Sie luden Grin zu einem Gastmahl, stießen ihn jedoch dann in eine Kammer, in der der ausgehungerte Löwe lag. Bevor das Tier sich aber auf ihn stürzen konnte, wurde es von dem tapferen Mann getötet. Die Domherren hängte man zur Strafe an die Pfaffenpforte, dem ehemaligen Nordtor der Stadt.
Die Geschichte geht auf zwei historische Ereignisse zurück: 1268 wurde Engelbert im Machtkampf um die Stadtherrschaft von seinen Gegnern aus Köln vertrieben; seither waren die Erzbischöfe gezwungen, in Bonn zu residieren. In der Schlacht bei Worringen im Jahr 1288 wurde sein Nachfolger Siegfried von Westerburg von den Kölner Bürgern besiegt, die an der Seite des Herzogs von Brabant kämpften. Köln wurde faktisch freie Reichsstadt - offiziell wurde ihr dieser Status aber erst 1475 durch Kaiser Friedrich III. verliehen.
Da die Erzbischöfe noch bis in das 16. Jahrhundert ihre Rechte in Köln zu behaupten suchten, avancierte der Löwenkampf des Bürgermeisters Grin zu einem Symbol der bürgerlichen Macht und der Befreiung. Dazu passt auch, dass das Gemälde im Stadtmuseum den Löwenkampf mit einer Schlachtenszene auf der rechten Bildseite verbindet.
Das Motiv des Löwenbezwingers, der den Sieg des Guten über das Böse verkörpert, lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. In der Mythologie ist es Herkules, der den unverwundbaren nemëischen Löwen erwürgt. Eine Darstellung dieses Themas könnte im mittelalterlichen Köln bekannt gewesen sein, entdeckte man doch dort im 19. Jahrhundert eine römische Skulptur. Sie stellt die charakteristische Szene der umhüllten Hand im Rachen des Tieres dar - ein Motiv, das sich im gesamten Mittelalter nachweisen lässt. Das Kunstwerk befindet sich heute im Römisch-Germanischen Museum in Köln. Im Alten Testament wird Samson, der einen Löwen ohne Waffen zerreißt, ebenso zu einem Vorbild, das den Triumph Christi und die Überwindung des Todes vorwegnimmt (Richter 13-16) wie Daniel durch seinen Aufenthalt in der Löwengrube (Dan. 6,2-29).
Dass man in Köln die lokale Legende aufwerten wollte, zeigten nicht zuletzt auch die Reliefs an der 1569 bis 1573 errichteten Laube des Rathauses, das wie kein anderer Bau der Stadt das Selbstbewusstsein der Bürger repräsentierte. An der Brüstung des Balkons, von dem der Rat seine Beschlüsse verkündete, befindet sich heute eine Kopie des Grin-Kampfes, flankiert von den beiden biblischen Helden Samson und Daniel, geschaffen jeweils im 19. Jahrhundert. Sie heben das Ereignis auf die Ebene eines göttlich legitimierten Geschehens. Auch im durch Lauben geöffneten Löwenhof prangt das Motiv des Löwenkampfes. Das heute als Kopie des 19. Jahrhunderts überlieferte Relief von 1594 verkündet ein weiteres Mal den Anspruch der Freien Reichsstadt Köln.
Die Häufung dieser Löwendarstellung ist ein typischer Ausdruck des bürgerlichen Selbstverständnisses, das bis heute andauert: Sind die Kölner doch dafür bekannt, ihre Stadt besonders zu lieben.
Julia Ricker
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Mittelalterliche Wandmalereien in Behrenhoff 16.01.2018 Die Hölle Vorpommerns Die Hölle Vorpommerns

In der Dorfkirche von Behrenhoff haben sich eindrucksvolle Darstellungen des Fegefeuers erhalten.
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Von Seekisten und Seeleuten 08.11.2012 Seekisten Was auf der hohen Kante lag

In den alten Zeiten der Frachtsegler musste die gesamte Habe des Seemanns in eine hölzerne Kiste passen. Manchmal liebevoll bemalt, war sie das einzige persönliche Stück, das ihn auf seinen Reisen über die Weltmeere begleitete.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz