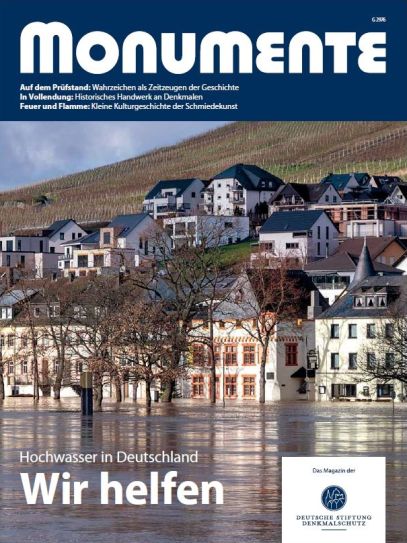Kurioses 1925 Dezember 2010
Bernhard Hoetger-Bauten in Bad Harzburg
Märchenhaftes in der Elfenecke
Ein Jahr lang suchte die Hotelierfamilie Kühn in ganz Deutschland nach einem schönen Haus, in dem sie Übernachtungen mit Frühstück anbieten wollte. Angekommen in Bad Harzburg, schlossen die Kühns das Café Winuwuk sofort in ihr Herz.
Sie waren begeistert von dem Gebäude, das keine gerade Wand besitzt und noch dazu von geschwungenen und natürlich gewachsenen Eichenbalken gestützte Dächer aufweist sowie farbenfroh verzierte Schnitzereien an Türen und Fenstern - und sie änderten ihre Pläne. Inzwischen bewirtschaften die Kühns seit 32 Jahren, jetzt in zweiter Generation, das hoch über Bad Harzburg, in der sogenannten Elfenecke gelegene Café Winuwuk und das gegenüberliegende Ausstellungsgebäude, den Sonnenhof.
Schon für die Bauherren, das Künstlerehepaar Dore und Walter Degener, war das phantastische Architekturensemble von 1922/23 die Verwirklichung eines Traums. Auch sie wollten in den zwanziger Jahren die avantgardistische Kunst in ihre Heimat holen und eine Möglichkeit für Ausstellungen und Lesungen schaffen. Da die Elfenecke damals abgelegen war, sollte eines der Gebäude zur Einkehr dienen. Für ihr Vorhaben gewannen sie Bernhard Hoetger (1874-1949), damals Professor an der Darmstädter Künstlerkolonie, dessen expressionistisches Werk Architektur, Bildhauerei, Malerei und Kunsthandwerk vereint.
Fasziniert von der einheimischen Bauweise verwendete Hoetger auch für die Fassaden der Bad Harzburger Fachwerkhäuser rote Dachziegel. Holz ist das vorherrschende Material der Innenräume, die imposante Gefüge aus knorrigen Balken besitzen. Beschnitzt und bemalt zeigen sie exotisch anmutende Wesen und Formen, die an indianische Kunst und die der Wikinger zugleich erinnern. Für beide Häuser erdachte der Künstler einen Mittelpunkt: im Café Winuwuk - der Name ist ein Akronym, das Hoetger aus den Anfangsbuchstaben von "Weg im Norden und Wunder und Kunst" zusammensetzte - eine wärmende Feuerstelle und im kreisrunden Atrium des Sonnenhofs einen erfrischenden Brunnen.
Hoetgers Kunst ist zwar durch germanische Mythen inspiriert, doch die Nationalsozialisten deklarierten seine Werke als entartet. 1939 mussten daher die Wandmalereien in den Innenräumen übertüncht und die figürlichen Darstellungen an Balken und Geländern entfernt werden. Die Gebäude, die später von den Engländern beschlagnahmt wurden und als Casino dienten, konnte die Familie Degener 1953 wieder übernehmen. Seither wird das Ensemble in seiner ursprünglichen Funktion genutzt. Inzwischen kümmern sich Dietmar Kühn und seine Schwester Petra, die ihre Diplomarbeit an der Kunsthochschule in Hamburg über Hoetger geschrieben hat, liebevoll um Café und Ausstellungsgebäude. "Ich kenne hier jeden Stein", sagt Dietmar Kühn, der von der Elektrik bis zur Aufarbeitung des von Hoetger entworfenen und noch vollständig erhaltenen Mobiliars alles selbst macht.

Doch inzwischen können die Besitzer die anfallenden Arbeiten nicht mehr alleine stemmen. Die Witterung hat der Holzkonstruktion zugesetzt. Sie leidet unter eindringender Feuchtigkeit und Pilzbefall. Auch das Fundament der Caféterrasse gibt nach. Seit September haben die Restaurierungsarbeiten an Terrasse und Eingangsgiebel des Sonnenhofs begonnen. An der Sanierung, bei der auch Teile der originalen Wandmalereien freigelegt werden, beteiligt sich neben dem Land, dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und den Eigentümern auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die zusammen mit der von ihr treuhänderisch verwalteten Horst v. Bassewitz-Stiftung zur Bauforschung 47.000 Euro zur Verfügung stellt.
Julia Ricker
Weitere Infos im WWW:
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Von Seekisten und Seeleuten 08.11.2012 Seekisten Was auf der hohen Kante lag

In den alten Zeiten der Frachtsegler musste die gesamte Habe des Seemanns in eine hölzerne Kiste passen. Manchmal liebevoll bemalt, war sie das einzige persönliche Stück, das ihn auf seinen Reisen über die Weltmeere begleitete.
-
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther 04.07.2017 Ulrich Müther Hyparschalen

Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
-
Otto Bartning und seine Kirchen 09.03.2016 Bartning Kirchen Spiritualität in Serie

Otto Bartning gehört zu den bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Wegweisend sind seine Raumschöpfungen im Bereich des protestantischen Kirchenbaus.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
Lesen Sie 4 Kommentare anderer Leser
-
 Kristine Bauer-Stisser schrieb am 24.03.2016 23:54 Uhr
Kristine Bauer-Stisser schrieb am 24.03.2016 23:54 UhrDanke für diesen Artikel. Das "Winuwuk" war laut Aussagen meiner Mutter - Jahrgang 1928 - ein sehr beliebtes Ausflugsziel für die Harzer Bevölkerung. Schon als kleines Mädchen bewunderte sie die etwas andere Architektur und Einrichtung. Sie war begeistert, als sie vor einigen Jahren das Gelände wieder sah und Dinge wieder erkannte, die sie in Erinnerung hatte.
Auf diesen Kommentar antworten -
 Karin Heufelder schrieb am 24.03.2016 23:55 Uhr
Karin Heufelder schrieb am 24.03.2016 23:55 UhrDas "Winuwuk" hat mich bei meinen Aufenthalten in Bad Harzburg immer begeistert. Ein tolles Gebäude.
Auf diesen Kommentar antworten -
 Sabine Straßburg schrieb am 24.03.2016 23:55 Uhr
Sabine Straßburg schrieb am 24.03.2016 23:55 UhrWie schön, so auch dieses Cafe von Hoetger kennen zu lernen. Bisher kannte ich nur sein Cafe Verrückt in Worpswede, die Böttcherstraße in Bremen und einige seiner eindrucksvollen Skulpturen. Es animiert mich, mich weiter mit diesem expressionistischen Architekten und Künstler zu befassen. Und wenn ich mal wieder in die Harz-Gegend komme, möchte ich das Cafe gerne besuchen, hoffentlich ist es dann nach der Renovierung wieder geöffnet.
Auf diesen Kommentar antworten
Anm. d. Red. Das Café Winuwuk ist auch während der Restaurierungsarbeiten geöffnet -
 Renate Pahlow schrieb am 24.03.2016 23:59 Uhr
Renate Pahlow schrieb am 24.03.2016 23:59 UhrSeit 30 Jahren sporadischer Gast im Cafe WINUWUK, fiel mir unlängst ein zu einem Krokodilskopf? auslaufender Deckenbalken auf. Im Moment noch braun gestrichen. Ähnliche Fabelwesen gibt es in der Jerusalemkirche zu Rüper, mit deren Bau ich mich beschäftigt habe. Ähnliche Darstellungen fand ich in den Lichtdrucken: "Germanische Frühkunst" 1906-1907 von Karl Mohrmann, dem Architekten der Jerusalemkirche. Gibt es da einen Zusammenhang? Prof. Mohrmann hat auch die Stabkirche in Hahnenklee gebaut.
Auf diesen Kommentar antworten
Mit freundlichen Grüße
Renate Pahlow
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz