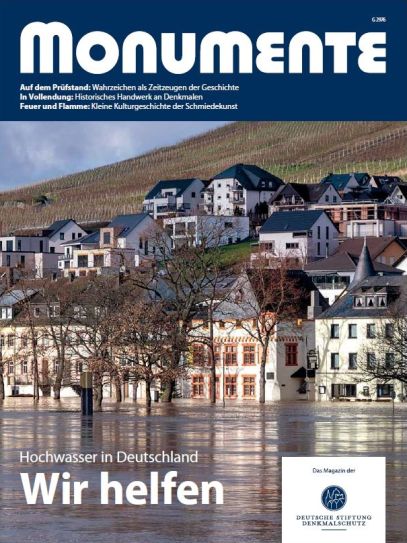Interieur Material April 2009 S
Eine kleine Kulturgeschichte des Spiegels
Der Zauber des Widerscheins
Kerzenschein, so weit das Auge reicht, die Pretiosen gleich mehrfach wiederholt, und der ganze Raum verliert sich im Unendlichen. Der Barockmensch war ein Sinnenmensch par excellence und hat - als wahren Schauplatz seiner Epoche - den Spiegelsaal kreiert. Denn, was konnte die Sinne mehr ansprechen als optische Täuschungen und der Zauber raffinierter Lichteffekte?
Auch in der kleinen Markgrafschaft Baden-Baden ging man mit der neuesten Architektur-Mode: Sibylla Augusta, die junge Witwe von Ludwig Wilhelm, ließ sich ab 1710 nahe der markgräflichen Residenz Rastatt einen Sommersitz errichten. Im Schloss Favorite ist eines der ältesten und prunkvollsten Spiegelkabinette zu bewundern, die in Deutschland erhalten sind: Durch schräg in die Wand- und Fensternischen eingesetzte Spiegel ist die Brechung des Lichts hier besonders bizarr.
Dabei war der erste Spiegel wohl schlicht eine glatte Wasseroberfläche. Im Mythos der griechischen Antike entdeckte Narziss sein Spiegelbild in einem Teich. Dass es sich dabei um sein Ebenbild handelte, war ihm allerdings noch nicht bewusst - er verliebte sich prompt in den Jüngling, der ihn dort anblickte. Das Phänomen des Widerscheins hat die Menschen seit jeher fasziniert, und so setzten sie alles daran, dieses optische Schauspiel zu imitieren.
Zunächst behalf man sich mit spiegelnden Steinen, später dann mit Metall. Die alten Ägypter kannten bereits um 3000 v. Chr. Handspiegel aus polierter Bronze. Um 400 v. Chr. setzte die Blütezeit griechischer Metallspiegel ein. In der hellenistischen Epoche wurden auch die ersten kleinen Standspiegel hergestellt. Dass solches Gerät die Eitelkeit förderte, liegt auf der Hand: Der berühmte Redner Demosthenes soll seine Auftritte vor einem Spiegel geübt haben.
Seit wann es Glasspiegel gibt, ist nicht genau zu rekonstruieren. Auf jeden Fall war die Spiegelherstellung ab dem 14. Jahrhundert in Europa etabliert. Dabei wurde das rund geblasene Glas mit einer Metallfolie hinterlegt oder auf der Rückseite mit Metall beschichtet. Für das Jahr 1373 ist eine Spieglerzunft in Nürnberg bezeugt; eine weitere Hochburg mittelalterlicher Spiegelherstellung war Flandern. Neben kleinen Tischspiegeln waren vor allem Taschen- oder Gürtelspiegel mit Elfenbeingriffen beliebt, die die Kammacher zum Beispiel als Brautgeschenk feil boten.
Zur Zeit der Renaissance gab es revolutionäre technische Neuerungen, die vom wasserumspülten Venedig ausgingen. Zum einen hatte man mittlerweile das Kristallglas entdeckt, zum anderen ging man nun dazu über, den Glasklumpen zu einem Zylinder auszublasen, der Länge nach aufzuschneiden und flach auszubreiten. Die so entstandene Scheibe wurde schließlich poliert und verzinnt. Glasspiegel waren also nicht mehr gewölbt und mussten auch nicht zwangsläufig rund sein.
Seit dem 16. Jahrhundert lieferte die Lagunenstadt die neuartigen Spiegel in alle Welt. Die Manufakturen auf der Insel Murano hatten sozusagen Monopolstellung und wurden strengstens bewacht. Aus gutem Grund, denn tatsächlich ist ein früher Fall von Werkspionage überliefert: Im 17. Jahrhundert soll es den Franzosen gelungen sein, einige Techniker von der Insel zu entführen, um so hinter das Geheimnis der venezianischen Spiegelherstellung zu kommen.
Die Franzosen Abraham Thewart und Lucas de Nehou entwickelten 1688 das noch heute gebräuchliche Schmelzgussverfahren: Dabei verteilt man die geschmolzene Glasmasse direkt auf dem metallenen Gusstisch und glättet sie dann mit einer Walze. Anschließend wird die Glasplatte geschliffen und mit einer Zinnfolie samt Quecksilberschicht belegt.
Dank der neuen Produktionsmethoden, die nicht nur flachere, sondern auch zunehmend größere Scheiben ermöglichten, wurde der Spiegel als Teil der Inneneinrichtung immer wichtiger. Schon Katharina von Medici soll im ausgehenden 16. Jahrhundert ein Kabinett besessen haben, bei dem 119 Spiegel in die Wandvertäfelung eingelassen waren. Man integrierte Spiegel in Möbelstücke und fasste Wand- oder Tischspiegel in kunstvoll gestaltete Rahmen aus edlen Materialien wie Gold, Silber, Schildpatt oder Elfenbein. Allerdings hatte der Zierrat nicht selten einen moralischen Beigeschmack: Tugendsymbole oder Sinnsprüche warnten vor Eitelkeit.
Seine Blütezeit erlebte der Spiegel als Teil der Raumgestaltung im Barock. Allerorten wurden Schlösser verschwenderisch mit Spiegeln ausgestattet: Wer mächtig und reich war, sonnte sich im Glanz des Materials und spielte mit der illusionistischen Steigerung der Pracht. Keiner beherrschte dies so wie Ludwig XIV. von Frankreich. Seine 1678-1686 errichtete Galerie des Glaces im Schloss von Versailles ließ der Sonnenkönig mit 300 Spiegeln auskleiden. Diese erste Spiegelgalerie wurde in ganz Europa kopiert und sollte doch die berühmteste bleiben.
Um 1700 siedelten sich auch in Deutschland Manufakturen an, in denen Spiegel nach dem französischen Verfahren hergestellt wurden. Eine der frühesten wurde 1698 von Lothar Franz von Schönborn in Lohr am Main gegründet - französische Schleifer hatten die Gussglastechnik nach Franken gebracht. Die Kurmainzische Spiegelmanufaktur bestand bis 1806 und lieferte Lohrer Spiegel bis nach Südamerika und Indien. Mit dem Rokoko wuchs der Bedarf an dem reflektierenden Glas stetig: Kaum eine neu erbaute Residenz oder ein Lustschlösschen, die nicht mit einem Spiegelkabinett ausgestattet worden wären. Vor allem im süddeutschen Raum war die Verbreitung groß.
Da Spiegel und Koketterie immer eng beieinander lagen, wurden natürlich auch weiterhin die kleinen Taschenspiegel produziert. Im 18. Jahrhundert - wo es gemäß französischer Hofetikette neun verschiedene Arten gab, das Schönheitspflaster zu platzieren - war dieses Utensil wichtiger denn je. Im Empire wurde der erste figurhohe, bewegliche Standspiegel, die sogenannte Psyché, gefertigt. Und wieder waren die Franzosen en vogue, als es darum ging, den prüfenden Blick auf die gesamte Toilette zu ermöglichen. Doch noch immer war der Spiegel ein Luxusgut, an dem sich vornehmlich der Adel erfreute: Ein großes Exemplar von hoher Qualität kostete immerhin genauso viel wie eine Kutsche.
Erst im 19. Jahrhundert reklamierte das Bürgertum Glanz und Selbstbespiegelung für sich: Der Spiegel wird nun auch in der bürgerlichen Wohnung zu einem wichtigen Einrichtungsgegenstand. Zudem stattet man öffentliche Räume wie Kaffeehäuser, Restaurants oder Theaterfoyers mit glänzenden Spiegelfronten aus.E
1857 wurde die Spiegelherstellung ein weiteres Mal verbessert: Dank der neu erfundenen Silberverzinnung konnten noch klarere Spiegel produziert werden. Durch den Verzicht auf die herkömmliche Verzinnung mit Quecksilber verbesserten sich vor allem die Arbeitsbedingungen - zuvor hatten die Handwerker erhebliche Gesundheitsschäden davongetragen.
Mit dem bayerischen König Ludwig II. und seinem Traum vom absolutistischen Königtum lebte der Glanz der barocken Spiegelgalerie auch im 19. Jahrhundert noch einmal auf. Auf der Insel Herrenchiemsee wollte sich der bauwütige Regent ab 1878 sein bayerisches Versailles errichten lassen, dessen Fertigstellung er allerdings nicht mehr erlebte. Mit 75 Metern Länge und 10 Metern Breite überbietet die Große Spiegelgalerie das französische Vorbild sogar um zwei Meter. Kein Wunder, dass die königliche Kabinettskasse mit diesem Schlossbau endgültig in die Pleite getrieben wurde.
In unseren modernen Städten können wir uns täglich in gläsernen Fassaden spiegeln. Und doch hat die Begegnung mit sich selbst bis heute etwas Magisches. Das Spiegelbild als Seele aufzufassen, ist noch nicht ganz in Vergessenheit geraten. In bestimmten Gegenden lebt die Tradition fort, bei einem Todesfall alle Spiegel im Haus zu verhüllen. Die lange Geschichte dieses Gegenstandes zeigt, dass imaginäre Bilder so alt wie die Menschheit sind.
Bettina Vaupel
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther 04.07.2017 Ulrich Müther Hyparschalen

Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Die neue Lust am Bungalow 08.11.2012 Bungalows Die Leichtigkeit des Steins

Fast 17 Millionen Dollar. Das ist auch für das Auktionshaus Christie's keine alltägliche Summe. Bei 16,8 Millionen Dollar ist im Mai bei einer Auktion in New York für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst der Zuschlag erfolgt, und zwar für - und das ist ebenso ungewöhnlich - ein Bauwerk. Nicht einmal ein besonders großes.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
Lesen Sie 1 Kommentar anderer Leser
-
 Nina schrieb am 20.12.2018 10:38 Uhr
Nina schrieb am 20.12.2018 10:38 UhrNeulich hat mich meine Tochter gefragt, seit wann es eigentlich Spiegel gibt. Daher danke für die interessante Beschreibung! Vielleicht frag ich auch mal in einer Glaserei an, ob man sich den Prozess mal vor Ort angucken könnte.
Auf diesen Kommentar antworten
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz