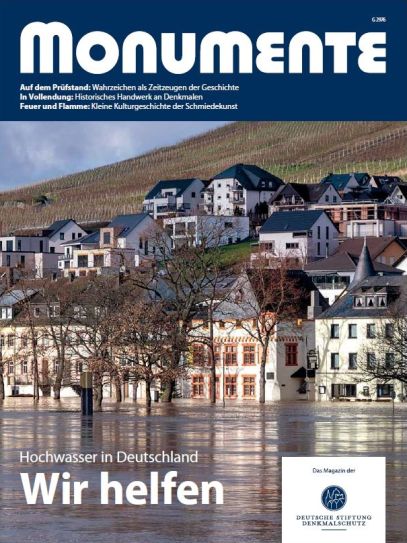Kleine und große Kirchen Februar 2009
Synagogen sind ein bedeutender Teil unserer Kulturgeschichte
Prächtig in der Stadt, schlicht auf dem Land
Synagogen waren einst ein wichtiger Teil der Baukunst in Deutschland, leider sind sehr viele von den Nationalsozialisten in der Reichspogromnacht 1938 zerstört worden. Die erhaltenen haben deshalb eine ganz besondere religions- und baugeschichtliche Bedeutung. Im Unterschied etwa zu katholischen Kirchen sind Synagogen keine heiligen Stätten, sondern Häuser der Versammlung, des Betens und des Lernens.
Wegen des strikten Verbots, sich von Gott ein Bildnis zu machen, wie das erste Gebot dies fordert, gibt es keine Statuen, figürlichen Reliefs oder Gemälde. Dieses absolute Bilderverbot galt auch im frühen Christentum und gilt heute noch im Islam.
Seit der endgültigen Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer im Jahr 70 nach Christus symbolisiert die Synagoge mehr das tragbare Zelt aus der Wüstenwanderung. Das kommt auch durch das Fehlen eines Altars zum Ausdruck und gleicht damit dem frühen Christentum und dem Islam - wie überhaupt die drei großen, dem Heiligen Land entstammenden monotheistischen Religionen manches gemeinsam haben.
Dennoch ist die Synagoge kein rein profaner Versammlungsraum, sondern neben der Stätte der Versammlung und des Belehrens auch ein Ort des Betens und geregelter sakraler Handlungen, denen man durch das Bedecken des Hauptes Respekt erweist. Während der Außenbau im Laufe der Stilentwicklungen ganz unterschiedlich gestaltet sein kann, folgt die Inneneinrichtung einem festen Schema. Danach betreten die Männer - es müssen für die Bildung einer jüdischen Gemeinde mindestens zehn sein - den meist rechteckigen Innenraum an der Schmalseite. Die Frauen müssen über eine Treppe auf die hier U-förmige Empore steigen und dürfen nur dort Platz nehmen. Inmitten des Raumes erhebt sich der Almemor, ein erhöhtes, von Schranken gerahmtes Podest, von dem aus der Rabbi vorträgt. Dieser ist kein geweihter Priester, sondern Schriftgelehrter und Laie wie alle anderen Beter. In der dem Eingang gegenüberliegenden Wand - meist nach Osten, nach Jerusalem ausgerichtet - befindet sich eine Nische, die sich häufig außen durch einen Mauervorsprung abzeichnet. Es handelt sich um den Aron Hakodesch, den heiligen Schrein. Er dient der Aufbewahrung der Thora genannten Schriftrollen, die bei bestimmten Gelegenheiten der Heiligen Lade entnommen, zum Almemor getragen und anschließend wieder zurückgebracht werden.
Zu den ältesten Synagogen in Deutschland zählt die Männersynagoge in Worms, erbaut 1174/75, 1938 zerstört und 1959-61 wiederhergestellt. Die Formen ihrer Portale, Säulen und Kapitelle gleichen denen des Wormser Domes, und es waren dessen christliche Steinmetzen, die auch an der Synagoge arbeiteten. Die Fenster wurden nach einer Beschädigung 1355 gotisch erneuert, die Gewölbe nach einer Zerstörung 1615 neu eingebracht. Die Ädikula des Thoraschreins entstammt der Barockzeit und zeigt Formen, wie sie auch bei Portalen oder Altarretabeln christlicher Kirchen vorkommen.
Zu jeder Synagoge gehörte ursprünglich ein rituelles Tauchbad, hebräisch Mikwah, im heutigen Sprachgebrauch Mikweh genannt. Die eindrucksvollste ist in Friedberg erhalten. Da für die rituelle Reinigung der Frauen Oberflächenwasser verboten und reines Grundwasser vorgeschrieben war, musste die jüdische Gemeinde hier eine 25 Meter tiefe Treppenanlage durch den Felsen schlagen lassen, um den bei 30 Metern Tiefe schwankenden Grundwasserspiegel zu erreichen. Den um 1260 meisterhaft angelegten gotischen Bau schufen dieselben Steinmetzen, die an der Stadtkirche in Friedberg tätig waren.
Im Zeitalter des Barock glichen die Synagogen wie die von Gelnhausen im Äußeren christlichen Saalkirchen. Sie war 1601 auf den Grundmauern eines mittelalterlichen Vorgängerbaus errichtet worden, wurde jedoch 1736 barock umgestaltet. Auch hier ist die Ähnlichkeit des Thoraschreins mit einem barocken christlichen Altarretabel sehr groß.
Die barocke Synagoge von Ansbach, erbaut 1744-46 nach den Plänen des italienischen Architekten Leopold Retty, hat einen besonders schönen Almemor, der einem oben offenen Baldachin gleicht (s. Kopfgrafik rechts). Die gewundenen Säulen waren bei christlichen Kirchen aller Konfessionen sehr beliebt, seit vier von ihnen im Petersdom in Rom das Altarziborium über dem Grab des Apostels trugen, gestaltet 1633 von Lorenzo Bernini. Der im Hintergrund durch den Almemor sichtbare Thoraschrein wird ebenfalls wie ein christliches Altarretabel durch gewundene Säulen gerahmt.
Bis zur Emanzipation des Judentums in Folge der Aufklärung lagen die Synagogen meist am Stadtrand hinter hohen Mauern verborgen, trugen also nicht wesentlich zum Stadtbild bei. Als Juden dann endlich deutsche Staatsbürger wurden und ihren alttestamentlichen Glauben offen zeigen durften, entstanden große, die Stadtsilhouette prägende Bauten. Jetzt konnte man sich auch von der Nachahmung christlicher Kirchen freimachen und suchte nach einer eigenen Bauweise, die die Herkunft aus dem Heiligen Land erkennen lassen sollte. Da es dort aber keinen spezifischen Synagogenstil gegeben hatte, boten zunächst die islamischen Bauten mit ihren orientalischen Formen das Vorbild, so bei der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte (s. Kopfgrafik links). Sie wurde 1859 von Eduard Knoblauch begonnen und 1866 von Friedrich August Stüler vollendet. In ihrem Äußeren mischen sich romantisierende Formen aus farbig glasierten Backsteinen mit einer Kuppel in moderner Eisenkonstruktion.
Im Zuge ihrer Assimilierung wollten die Juden ihre Herkunft aus dem Orient nicht überbetonen. Deshalb wählten die Architekten William Lossow und Max Hans Kühne 1909-11 bei ihrem Monumentalbau in Görlitz den damals bevorzugten Jugendstil, und verwendeten innovativen Stahlbeton. Um mit den christlichen Kirchtürmen im Stadtbild konkurrieren zu können, wird die Synagoge von einem zentralen hohen Turm mit einer Kuppel bekrönt, die allerdings nicht den Innenraum abschließt. Dort liegt die Kuppel direkt auf der Mauerkrone, über ihr erstreckt sich ein nicht nutzbarer Hohlraum. Es ging also in erster Linie darum, in einem neu entwickelten Selbstbewusstsein den Kultbau der jüdischen Gemeinde in Erscheinung treten zu lassen, was freilich durch die hohen Bäume im nahen Stadtpark nur begrenzt gelang.
Die Eingangsseite des Innenraumes wird von der geschwungenen Frauenempore eingenommen, auf der gegenüberliegenden Seite sind noch Reste des Thoraschreines vorhanden. Am Rand der Kuppel schreiten aus Stuck gearbeitete Löwen wie am Thron von Salomon - als bildliche Darstellung von Lebewesen neu in der Geschichte des Synagogenbaus. Darüber ist die Kuppel mit einem Schuppenmuster um die Mittelrosette ungewöhnlich reich verziert.
Doch nicht nur größere jüdische Gemeinden in den Städten hatten Synagogen, sondern es gab auch zahlreiche in den Dörfern, die sich äußerlich von den bäuerlichen Wohnbauten und Scheunen kaum unterschieden. Das trifft auch für die Synagoge im hessischen Romrod zu. Hier hatte die jüdische Gemeinde 1837 einen 1722 erbauten Streckhof aus Fachwerk gekauft. Sie ließ 1846 die Scheune im rechten Teil zur Synagoge umbauen, im anschließenden Wohnhaus wurden Schulraum, Lehrerwohnung und ein kleines Frauenbad eingerichtet. Durch den Verkauf in Privathand blieb der Bau in der Reichspogromnacht verschont. 1988 erwarb ihn die Stadt Romrod und stellte den schlichten Synagogenraum nach den vorhandenen Fragmenten wieder her. Zwei Säulen mit orientalisierenden Kapitellen tragen die Frauenempore, der ehemalige Thoraschrein wurde nach den erkennbaren Spuren in den Umrissen angedeutet. Wegen ihrer unauffälligen, den Bauernhöfen ähnlichen Gestalt blieben in Hessen zahlreiche Synagogen in den Dörfern erhalten. Sie stehen heute alle unter Denkmalschutz und dienen meist kulturellen Zwecken, vor allem aber der Erinnerung an einen wichtigen, brutal vernichteten Teil unserer Kulturgeschichte.
Prof. Dr. Dr. E. h. Gottfried Kiesow
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Die neue Lust am Bungalow 08.11.2012 Bungalows Die Leichtigkeit des Steins

Fast 17 Millionen Dollar. Das ist auch für das Auktionshaus Christie's keine alltägliche Summe. Bei 16,8 Millionen Dollar ist im Mai bei einer Auktion in New York für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst der Zuschlag erfolgt, und zwar für - und das ist ebenso ungewöhnlich - ein Bauwerk. Nicht einmal ein besonders großes.
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Von Seekisten und Seeleuten 08.11.2012 Seekisten Was auf der hohen Kante lag

In den alten Zeiten der Frachtsegler musste die gesamte Habe des Seemanns in eine hölzerne Kiste passen. Manchmal liebevoll bemalt, war sie das einzige persönliche Stück, das ihn auf seinen Reisen über die Weltmeere begleitete.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz