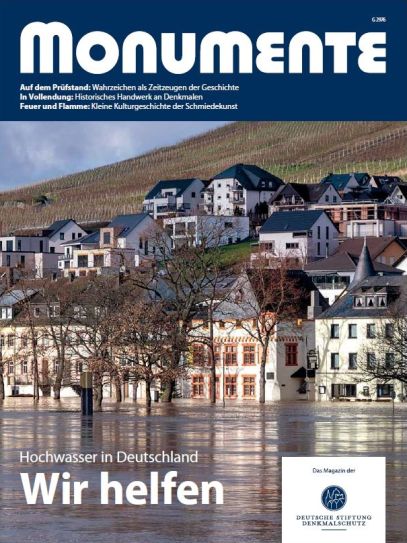Archäologie
Eine keltische Saline in Bad Nauheim
Ein Wald für Salz
Ein sechsgeschossiger Neubau, dazu eine Straße mit jungen Bäumen und eine große Rasenfläche: Nur Eingeweihte wissen, dass sich auf diesem Areal in Bad Nauheim ein Teil einer der größten Salinenanlagen aus der Keltenzeit befand. Schon seit über 50 Jahren ist das hessische Heilbad, das bis 1959 Salinen betrieb, eine wahre Fundgrube für Archäologen, die sich besonders für die keltische Epoche interessieren.
Unmittelbar zwischen der Dankeskirche und dem großen Jugendstil-Kurbezirk begann man 2001 einen Ausschnitt der keltischen Salzproduktionsstätte freizulegen, die dort vom 4. bis zum 1. Jahrhundert v. Chr. in geradezu industriellem Ausmaß betrieben wurde: Die gesamte Innenstadt Bad Nauheims, rund 1,2 Kilometer lang, liegt auf der Saline. Man fand zahllose Holzwannen, in denen die in Quellen zu Tage tretende dreiprozentige Sole vorgradiert wurde. Das heißt, man ließ sie zunächst auf natürliche Weise verdunsten, um den Salzgehalt zu steigern. Dann gaben die Söder sie in Siedegefäße, die auf Tonstützen in langen, schmalen Öfen aus Lehm hintereinander aufgestellt waren.
Die Öfen wurden so lange erhitzt, bis das Wasser vollständig verdunstet war und in den Gefäßen nur noch die Salzkristalle lagen. Mit der Asche des Feuerholzes füllte man unbenutzte Salinenbereiche auf. Der enorme Holzverbrauch lässt vermuten, dass in keltischer Zeit der ganze Wald um Nauheim abgeholzt wurde.
Für die Archäologen erwies sich die 5.000 Quadratmeter große Fläche als hochinteressantes, wenn auch nur in aufwendiger Technik zu erforschendes Grabungsfeld. Denn Aufbau und Planierung der Öfen, Ablagerung von Holzasche und wechselnde Werkplätze hatten über vier Jahrhunderte eine fünf Meter hohe Bodenschicht anwachsen lassen. In ihr stieß man auf sensationelle Befunde, wie zum Beispiel auf gepflasterte Arbeitsplattformen aus Basaltgestein und hölzerne Zuleitungen, Schöpfbecken, Wandgeflechte von Gradierbecken sowie auf botanische Reste, die besondere vegetationsgeschichtliche Untersuchungen für die Keltenzeit - in der Fachsprache auch Latènezeit genannt - erlaubten.
Die Funde aus der Arbeitswelt der Kelten waren so gut erhalten, dass die routinemäßige Grabung im Vorfeld einer Baumaßnahme schnell zu einer überregional bedeutenden Wissenschaftsgrabung zur Erforschung der keltischen Epoche avancierte. Mit Mitteln aus der Lotterie GlücksSpirale stellte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 2003 - neben dem Landesamt für Denkmalpflege und der Kommission für Archäologische Landesforschung in Hessen e. V. - einen Betrag von 25.000 Euro bereit, damit die Grabung abgeschlossen und dokumentiert werden konnte. Konserviert und sortiert, warten Tausende von Hölzern und Scherben nun auf ihre Entschlüsselung.
Christiane Rossner
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Otto Bartning und seine Kirchen 09.03.2016 Bartning Kirchen Spiritualität in Serie

Otto Bartning gehört zu den bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Wegweisend sind seine Raumschöpfungen im Bereich des protestantischen Kirchenbaus.
-
Mittelalterliche Wandmalereien in Behrenhoff 16.01.2018 Die Hölle Vorpommerns Die Hölle Vorpommerns

In der Dorfkirche von Behrenhoff haben sich eindrucksvolle Darstellungen des Fegefeuers erhalten.
-
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther 04.07.2017 Ulrich Müther Hyparschalen

Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz