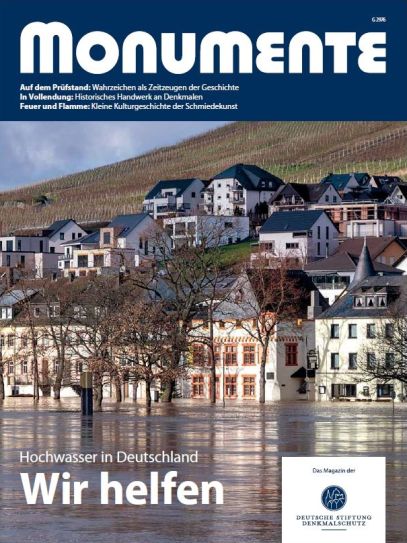Landschaften, Parks und Friedhöfe Juni 2008 K
Das Karussell in Hanau wird restauriert
24 Kreuzer "für 12 mal umzufahren"
Es muss ein unglaubliches Spektakel gewesen sein, das der französische König Ludwig XIV. aus Freude über die Geburt seines Sohnes Louis 1662 veranstaltete. Es entsprach dem Selbstverständnis des Sonnenkönigs, dass er den Festumzug als römischer Imperator verkleidet anführte. Ihm folgten 500 Reiter in pracht- und phantasievollen Kostümen. "Carrouse" wurde ein solches Festgelage genannt, und als "Carrousel" bezeichnete man verschiedene Reiterspiele, die dort veranstaltet wurden. Darunter auch das Ringelstechen, bei dem die Reiter mit ihren Lanzen Ringe treffen mussten.
Ende des 17. Jahrhunderts entwickelte man für dieses Geschicklichkeitsspiel eine spezielle Vorrichtung: Die Reiter wurden zunächst auf lebendigen, später auf künstlichen Pferden sitzend im Kreis geführt und mussten dabei Ringe auf Lanzen aufstecken. Daraus entwickelten sich die Karussells, die noch heute auf keinem Jahrmarkt fehlen dürfen.
Eines der frühesten Exemplare in Deutschland wurde 1779/80 in Wilhelmsbad bei Hanau aufgestellt. Dort hatte Erbprinz Wilhelm von Hessen-Kassel von seinem Baumeister Franz Ludwig Cancrin Kur- und Badeanlagen errichten lassen, die in einen schönen Landschaftspark eingebettet sind. Um die Zahl der Gäste zu erhöhen, dachte man auch an ihr Vergnügen und baute unter anderem ein Komödienhaus und eben ein Karussell.
Zunächst wurde ein Hügel aufgeschüttet, auf dem Cancrin einen kleinen Rundtempel errichtete. Für die Mechanik des Karussells ließ er sich
etwas ganz Besonderes einfallen: Die Pferde und Wagen befestigte er auf dem Rand eines großen und waagerecht liegenden Ringes. Um zu verhindern, dass sich der innere Kreis des Karussells mitdreht, hängte er ihn mittels zwölf mit Eisen verstärkten Holzbalken an die Dachkonstruktion. Die Balken wurden durch Säulen ummantelt. Das Karussell wurde vom Inneren des Hügels aus betrieben - zunächst von Menschen, später von Eseln und schließlich von einem Motor. Man nahm auf "zwei Phaëtons, die mit zwei Pferden bespannt waren, nebst zwei gesonderten Sattelpferden" Platz, wie Erbprinz Wilhelm in seinen Memoiren notierte. Das Vergnügen kostete "für 12 mal umzufahren, die Person" 24 Kreuzer.
Diese Ausstattung wurde Ende 1871 zerstört und später durch vier Kutschen mit je vier Pferden ersetzt. Der Rundtempel mit der Cancrinschen Konstruktion blieb zwar im Original erhalten, drehen kann sich das Karussell aber schon seit vielen Jahren nicht mehr, weil die Berechnungen des Baumeisters nicht stimmten. Die Hölzer des Dachstuhls können nämlich die schwere Last des inneren Kreises nicht tragen, so dass sich die Platte abgesenkt hat und den Drehmechanismus blockiert.
Damit wollten sich einige Hanauer Bürger nicht zufriedengeben. Sie gründeten 1998 einen Förderverein und sammelten mit viel Engagement bislang 525.000 Euro für die Restaurierung des wertvollen Karussells, das zusammen mit den anderen Gebäuden des ehemaligen Kurbades dem Land Hessen gehört. Von dort kommen auch mit 350.000 Euro die meisten Mittel für die Maßnahmen dieses Jahres, der Förderverein stellte 190.000 Euro bereit, und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gab 50.000 Euro für Zimmererarbeiten.
Bevor mit der Restaurierung begonnen werden kann, sind langwierige Voruntersuchungen nötig. Die Mitglieder des Fördervereins fiebern dem Tag entgegen, an dem sie endlich zu nostalgischen Karussellfahrten in die Kutschen einsteigen können - auch wenn die Einweihung nicht so aufwendig gestaltet werden dürfte, wie einst das "Carrouse" Ludwigs XIV.
Carola Nathan
Literatur:
Gerhard Bott: Heilübung und Amüsement - Das Wilhelmsbad des Erbprinzen. ConCon Verlag, Hanau 2008. ISBN 978-3-937774-00-8, 312 S., 29,80 Euro.
Margit Ramus: Wie alles begann ... Jahrmarkt, Fahrendes Volk und Karussells. Komet Druck- und Verlagshaus GmbH, Pirmasens 2004. ISBN 3-00015714-X,
25 Euro.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren
-
Albrecht Dürer und die Kartierung der Sterne 13.01.2016 Himmelskarten Der Hase am Südhimmel

Sie spüren Kugelsternhaufen und Satellitengalaxien auf: Heutige Astronomen können Milliarden Lichtjahre weit ins All blicken. Vor 500 Jahren – das Fernrohr war noch nicht erfunden – sah unser Bild vom Himmel ganz anders aus.
-
Zum 10. Todestag von Ulrich Müther 04.07.2017 Ulrich Müther Hyparschalen

Sie sind nur wenige Zentimeter dünn und überspannen dennoch große Hallen. Stützenfrei. Sie sind ingenieurtechnische Meisterleistungen und begeistern durch ihre kühnen Formen.
-
Mittelalterliche Wandmalereien in Behrenhoff 16.01.2018 Die Hölle Vorpommerns Die Hölle Vorpommerns

In der Dorfkirche von Behrenhoff haben sich eindrucksvolle Darstellungen des Fegefeuers erhalten.
Service
Newsletter
Lassen Sie sich per E-Mail informieren,
wenn eine neue Ausgabe von Monumente
Online erscheint.
Spenden für Denkmale
Auch kleinste Beträge zählen!
0 Kommentare
Schreiben Sie einen Kommentar!
Antwort auf: Direkt auf das Thema antworten
© 2023 Deutsche Stiftung Denkmalschutz • Monumente Online • Schlegelstraße 1 • 53113 Bonn
Spenden | Kontakt | Impressum | Datenschutz